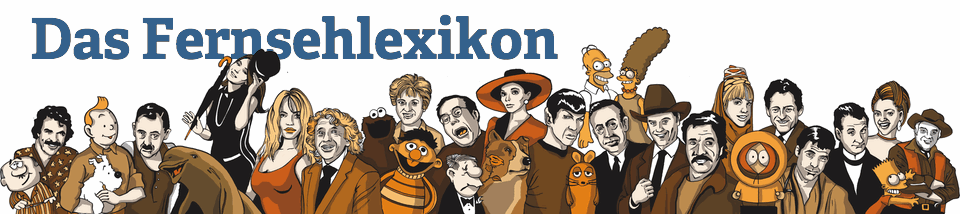Die glückliche Familie
1987–1991 (ARD). 52-tlg. dt. Familienserie von Jörg Grünler und Eckhart Schmidt.
Die glückliche Familie Behringer wohnt in München. Maria (Maria Schell) ist Hausfrau und nebenberufliche Journalistin, Ehemann Florian (Siegfried Rauch) Diplom-Ingenieur. Das Paar hat drei Töchter: Katja (Maria Furtwängler) studiert bereits, Nesthäkchen Tami (Susanna Wellenbrink) geht noch zur Schule, Teenager Alex (Julia Heinemann) anfangs auch, dann macht sie eine Lehre bei einem Modellschneider und eröffnet eine Boutique, mit der sie jedoch baden geht. Michael (Thomas Ohrner) ist ihr erster Freund. Erna (Elisabeth Welz) ist die Haushälterin der glücklichen Familie. Opa Behringer (Fritz Strassner) heiratet seine Freundin Ilse (Mady Rahl), und Katja heiratet im Frühjahr 1990 James (Jonathan Ryan). Kurz danach wird Alex von Richy (Sönke Wortmann) schwanger und bringt Titian (Jennifer Nerad) zur Welt. Von Richy trennt sie sich nach einiger Zeit wieder. Im Sommer des gleichen Jahres nehmen die Behringers ein Angebot aus Amerika an und wandern aus. Ein halbes Jahr später kommt die glückliche Familie enttäuscht zurück. Maria beginnt, ein Buch über die Familie zu schreiben. Katja lässt sich scheiden, Ilse verfällt einer Sekte, Maria erkrankt an einem Hirntumor und stirbt. Die glückliche Familie muss ohne sie auskommen.
Die einstündigen Folgen liefen mittwochs im Vorabendprogramm.
Die Goldene Europa
1981—2002 (ARD). Show zur Verleihung der Goldenen Europa.
Der Preis wird seit 1968 jährlich in Saarbrücken vom Saarländischen Rundfunk und seiner Europawelle Saar verliehen. Ursprünglich sollte er helfen, deutsche Künstler und Produzenten mit ihrer Musik gegen die Konkurrenz aus den USA und England zu unterstützen – und wer es nach dieser Beschreibung nicht gleich errät: Sein Erfinder ist Dieter Thomas Heck. Er hatte ein Jahr zuvor begonnen, die „Deutsche Schlagerparade“ bei der Europawelle Saar zu moderieren. 1973 gewann Heck die von ihm erfundene Auszeichnung übrigens selbst.
1981 wurde die Übertragung erstmals mit einer eigenen Fernsehshow verbunden. Es moderierte nun bis 1991 Manfred Sexauer. Ab 1992 übernahmen verschiedene Moderatoren die Sendung, darunter Karsten Speck, Jan Hofer und Hape Kerkeling – den dramatischen Quotenrückgang von über elf Millionen 1987 auf am Ende nicht einmal drei Millionen konnte keiner von ihnen stoppen. Vermutlich lag es daran, dass auch die Zuschauer nicht wussten, wofür genau es eine Goldene Europagab. Das Konzept wurde 1987 und 1992 geändert, blieb aber schwammig: Zuletzt sollten Künstler, deren Tätigkeit „im weitesten Sinne massenattraktive Unterhaltung darstellt“, ausgezeichnet werden. Seit 2003 hat die Goldene Europa nicht einmal mehr eine eigene Fernsehsendung, sondern wird im Rahmen des Festivals des Deutschen Schlagers verliehen. In jenem Jahr wurden ausgezeichnet: Paul Kuhn (für sein Lebenswerk), die Puhdys (für „jahrzehntelange Erfolge im Deutsch-Rock“) und Otto Waalkes (für „20 Jahre Comedy-Erfolg“). Falls 2004 und in den folgenden Jahren eine Verleihung stattgefunden haben sollte, drang über sie nichts in die Öffentlichkeit.
Die Goldene Stimmgabel
Seit 1990 (ARD, ZDF). Einmal im Jahr verleiht Dieter Thomas Heck den Musikpreis Goldene Stimmgabel an erfolgreiche deutsche Schlagerinterpreten.
ARD oder ZDF zeigten die Verleihung in unregelmäßigem Wechsel in ihrem Abendprogramm, seit 2001 läuft sie nur noch im ZDF. Dieter Thomas Hecks Firma Dito Multimedia produzierte die Sendung. Die Goldene Stimmgabel wurde bereits seit 1981 jährlich verliehen, damals im Rahmen der Sendung Tag des deutschen Schlagers.
1995 sorgte Stefan Raab für einen Skandal, als er seine Lippen nicht zum Vollplayback bewegte.
Die Gong-Show
1981 (NDR); 1992–1993 (RTL); 2003 (Sat.1). Comedy-Varietyshow, in der unbekannte Nachwuchstalente auftreten und zum Besten geben, was sie zu können glauben.
Eine Jury aus Prominenten befindet darüber, wie gut das wirklich ist, und wenn sie die Nase voll haben, schlägt einer auf einen scheppernden Gong, um die Darbietung abzubrechen. Alle Auftritte, die zu Ende gebracht werden können, werden mit 1 bis 10 Punkten benotet. Wer am Ende einer Show die meisten hat, bekommt eine Trophäe zum Andenken.
Paul Kuhn war der Moderator der ersten Version der Show, die es nur auf vier Ausgaben brachte. Sie liefen samstags am frühen Abend auf N3. In der Jury saßen Karl Dall, Elisabeth Volkmann und Carlo von Tiedemann. Vorbild war die gleichnamige US-„Gong Show“ mit Chuck Barris als Autor, Produzent und Moderator.
1992 legte RTL die Show als Halbstünder im Spätprogramm am Montagabend neu auf, Moderator war jetzt Götz Alsmann, die Jury bestand in der ersten Staffel aus Ingolf Lück, Peter Nottmeier und Isabell Trimborn, in der zweiten aus Lück, Anja Zink und Wigald Boning. Die Fernsehzeitschrift „Gong“ ließ im Abspann darauf hinweisen, dass sie mit der Show nichts zu tun habe.
Weitere zehn Jahre später reanimierte Sat.1 die Sendung mit Marco Ströhlein am frühen Samstagabend, in der Jury saßen Mirja Boes, Guido Cantz und Bürger Lars Dietrich. Die Fernsehzeitschrift „Gong“ war jetzt der Sponsor.
Die Grashüpfer
1974–1982 (ARD). 31-tlg. frz.-dt. Historien-Abenteuerserie von Jean-Louis Lignerat, Jean Vermorel und Rene Wheeler („Les Faucheurs de marguerites“; 1974–1977).
Die Serie mischt die historischen Eckpunkte in der Geschichte der Fliegerei von 1896 bis 1938 mit Spielhandlung. Jede Staffel hatte einen eigenen Untertitel.
1. Staffel: „Pioniere der Fliegerei“; Regie: Marcel Camus.
Der französische Fabrikantensohn Edouard Dabert (Bruno Pradal) wird durch Otto von Lilienthal inspiriert und von ihm persönlich ermuntert, sich der Fliegerei zu widmen. Außer Lilienthal reist er auch den Brüdern Voisin, den Brüdern Wright und Graf Zeppelin nach, um bei ihren jeweiligen Flugversuchen dabeizusein. Auslöser des Interesses war Edouards Freund Jules Joly (Clément Michu), der im Auftrag der Brüder Lumière Lilienthals Experimente filmen sollte und Edouard mitnahm. Lilienthals tödlicher Unfall schreckt Edouard nicht ab, und so gehen er, Gabriel Voisin (Jean-Jacques Moreau) und Lilienthals Mechaniker Hans Meister (Gernot Endemann) selbst unter die Flugmaschinenbauer. Zur Finanzierung heiratet Edouard die reiche Perrier-Erbin Jeanne (Christine Wodetzky), deren Onkel Pouderou (Alexander May) sich auch gleich beteiligt. Aus der Ehe geht Sohn Julien (Fabrice Boterel; später gespielt von Georges Caudron und Daniel Rivière) hervor, doch dann zerbricht sie. Nach einigen Intrigen, Fehlschlägen und Unglücken gelingen schließlich Erfolge. Eine Flugdemonstration von Wilbur Wright glückt, und schließlich überquert Bleriot als Erster den Ärmelkanal. Dank der Flugzeuge, so die Überzeugung, seien Kriege nun nicht mehr durchführbar.
2. Staffel: „Ritter der Lüfte“; Regie: Claude Boissol.
Die neuen Folgen lehren unsere Protagonisten, was wir heute wissen: Kriege waren sehr wohl weiterhin durchführbar. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, müssen die Freunde Edouard Dabert und Hans Meister voneinander Abschied nehmen, um im Krieg auf gegnerischen Seiten zu kämpfen. Edouards Ex-Frau Jeanne stirbt, was ihn sehr belastet. In Etienne Leroux (Jean-Claude Dauphin) findet er einen neuen Partner, und nach dem Ende des Krieges rüsten sich die Flugpioniere zu neuen Tests.
3. Staffel: „Eroberer des Himmels“; Regie: Jean-Claude Bonnardot.
Die ersten Fluggesellschaften entstehen, erste Linienflüge heben ab, und Edouard und seine deutschen Freunde Meister, Fechter (Ekkehardt Belle), Helmut Lutz (Amadeus August) und „Professor“ Sohlke (Franz Rudnick) mischen wieder mit. Auch Julien ist unter die Flieger gegangen, fällt aber durch riskante Kunststückchen auf. Er heiratet Louise Derblay (Anne-Marie Besse) und findet einen Job als Linienpilot. Hans Meister verursacht einen Skandal, als er kurzfristig für den verhinderten Julien einspringt und nach Paris fliegt, was für Deutsche verboten ist. Er und Edouard werden entlassen, Julien kündigt aus Solidarität und geht zur Konkurrenz.
4. Staffel: „Bezwinger der Kontinente“; Regie: Jean-Pierre Decourt.
Die Entwicklung schreitet fort. Hans Meister macht einen Probeflug mit Raketenschubkraft, ein Lebensmittelhändler fliegt mit einem selbstgebastelten Flugzeug, der Konkurrenzkampf zwischen immer mehr Fluggesellschaften wird härter, und Sohlke testet 1937 den ersten Hubschrauber. Das ist eine Sensation, denn das Ding hat ja gar keine Flügel.
Die Serie lief im regionalen Vorabendprogramm. Die 13 Folgen der ersten Staffel waren 25 Minuten lang, die jeweils sechs Folgen der weiteren Staffeln hatten die doppelte Länge.
Die große Hilfe
1976–1995. Zehnminütige Berichte über die Taten der Aktion Sorgenkind. Lief zunächst immer nach Wim Thoelkes Quiz Der große Preis, das im Dienst dieser gemeinnützigen Organisation stand, und wanderte 1992 auf den Samstagvorabend.
Die große Knoff-hoff-Show
2002–2004 (ZDF). Dreieinhalb Jahre nach dem Ende der erfolgreichen Knoff-hoff-Show kehrte Joachim Bublath mit der Show zurück, jetzt als einstündige Gala unter vergrößertem Titel.
Die Neuauflage lief in loser Folge am Donnerstagabend um 20.15 Uhr. Das Konzept blieb im Prinzip gleich, neu waren Prominente, die als Versuchskaninchen fungierten und Co‑Moderatorin Monica Lierhaus, die im März 2004 durch Kim Fisher ersetzt wurde.
Am Ende der Show fuhren Bublath und seine jeweilige Co‑Moderatorin auf einem Tandem weg, auf dem sie Rücken an Rücken saßen und in die entgegengesetzte Richtung strampelten. Das Fahrrad fuhr immer nur in Bublaths Richtung.
Die Harald Schmidt Show
1995–2003 (Sat.1). Late-Night-Show mit Harald Schmidt.
Die Harald Schmidt Show war anfangs eine noch perfektere Kopie der amerikanischen Late Show with David Letterman als die RTL-Nachtshow mit Thomas Koschwitz, entwickelte aber nach einiger Zeit ein erstaunliches Eigenleben. Jede Sendung begann mit einem Monolog und Einspielfilmen mit Gags zum aktuellen Tagesgeschehen. In der zweiten Hälfte der Show saß Schmidt hinter einem Schreibtisch und empfing prominente Gäste. Wie in jeder klassischen Late-Night-Show gab es auch eine Live-Band im Studio, die die Gags mit kurzen Tuschs begleitete und die Titelmusik spielte. Bandleader und gelegentlicher Comedy-Spielpartner war Helmut Zerlett.
Nach schwachem Start wurde die Harald Schmidt Show trotz weiterhin nur durchwachsener Einschaltquoten schon bald zur Institution. Highlights der frühen Jahre waren Comedyrubriken wie „Die dicken Kinder von Landau“ oder „Die Weisheiten des Konfuzius“. In Letzterer gaben zwei asiatische Kellner deutsche Sprichwörter oder Schlagertexte zum Besten. Herr Li und Herr Wang arbeiteten in einem Restaurant neben dem Kölner Capitol, wo die Show bis Mitte 1998 aufgezeichnet wurde.
Weitere wiederkehrende Figuren waren der angeberische Reporter Kai Edel (Chefautor Peter Rütten), Schmidts Fahrer Üzgür, Frau Asenbaum, Vatta Theresa, die Handpuppen Bimmel und Bommel, die Begriffe zu einem Buchstaben aus dem „Alfabet“ demonstrierten, am Ende aber immer beim „guten A“ landeten, der imaginäre Co-Moderator Horst und der „Politiker“ Dr. Udo Brömme (Gagautor Ralf Kabelka), der auf der Straße seine Botschaft „Zukunft ist gut für alle!“ verkündete und sich sogar bis in den echten Bundestag einschleichen konnte. Die meisten dieser Figuren verschwanden nach einiger Zeit wieder, und neue kamen hinzu. Ein Glas Wasser auf seinem Tisch blieb, der dazugehörige Spruch „Ich sage Ja zu deutschem Wasser!“ verschwand wieder, nicht ohne zuvor zum geflügelten Wort und auf T-Shirts gedruckt zu werden. Jeden Monat bestimmte Schmidt einen Prominenten als „Liebling des Monats“, dessen Foto dann seinen Schreibtisch zierte und als Witzvorlage diente.
Für Aufsehen sorgte in den ersten Jahren vor allem Schmidts Lust am kalkulierten Tabubruch. Jahrelang profilierte er sich mit Polenwitzen, gegen die u. a. deutsche Journalisten und Kulturschaffende in Polen protestierten. Genussvoll und zynisch spielte er im Kampf gegen sinkende Quoten den „Dirty Harry“, der Zoten reißt und frauenfeindliche Witze erzählt. Im Dezember 1995 zeigte er eine Ausgabe der Frauenzeitschrift „Emma“, Eierlikör, eine Kloschüssel und Bettina Böttinger und fragte: „Was haben diese vier Dinge gemeinsam? Das sind die vier Dinge, die kein Mann freiwillig anfassen würde.“ In der Folge machte er immer neue gehässige Anspielungen auf die Homosexualität der Moderatorin. Sie kam schließlich in seine Show, sagte, dass sie das „sehr verletzt“ habe, und ging vorzeitig wieder. Andererseits spielte Schmidt großartig mit Selbstironie, ließ z. B. die Post von einem „Letter-Man“ bringen und den Weg vom Anfangs-Stand-up zu seinem Schreibtisch, während dessen große Teile der Zuschauer immer abschalteten, von einer Sat.1-Ansagerin mit der Bitte moderieren, nun nicht abzuschalten.
1998 trennte sich Schmidt im Streit von der bisherigen Produktionsfirma Brainpool, die schon die RTL-Nachtshow mit Thomas Koschwitz hergestellt hatte, und ließ die Show ab Sommer von seiner eigenen Firma Bonito TV produzieren. Damit verbunden war der Umzug vom Capitol ins Studio 449 in Köln-Mülheim.
Ab 2000 stand auf der Bühne ein zweiter Schreibtisch, hinter dem Redaktionsleiter Manuel Andrack saß, mit dem sich Schmidt während der Sendung über Nietzsche, Kant, den Expressionismus und andere Bildungsbürgerthemen unterhielt. Oder auch über Fußball. Die Show hatte nach und nach eine neue Richtung bekommen, als Schmidt den „Dirty Harry“ immer mehr durch einen konservativen Bildungsbürger ersetzte, aber den Klamauk fortführte. In einem Interview mit „TV Today“ beschrieb er Anfang 2001 seine Sendung so: „Da erklärt einer Max Planck, und hinterher rennt einer nackt über die Bühne und wird mit Gummibärchen beworfen. Das ist etwas, worauf ich stolz bin, dass ich Stimmungsmacher Fips Asmussen und Schriftsteller Karl Ignaz Hennetmair in der Sendung haben kann.“ Auch andere Mitglieder des Teams wurden vermehrt ins Bild gerückt, vor allem die Rezeptionistin Natalie Licard, die schon seit Jahren mit französischem Akzent den Vorspann sprach, und Suzana Novinscak, die eigentlich dafür zuständig war, die Papptafeln mit Schmidts Moderationstexten hochzuhalten.
Schmidt hatte am Revers seines Anzugs eine „Rinder-gegen-den-Wahnsinn-Schleife“ in Form eines Kuhschwanzes angesteckt, um die Hysterie um BSE in Großbritannien zu karikieren. Die Schleife wurde im Fanshop verkauft und einer CD mit Musik aus der Show beigelegt. Schmidt trug sie über Jahre jeden Abend und machte auch kein großes Aufhebens um sie, als die BSE-Krise Anfang 2001 Deutschland erreichte. Im Herbst des gleichen Jahres erschien er plötzlich ohne die Schleife und verkündete: „BSE ist geheilt!“
Nach den Terroranschlägen in den USA am 11. September 2001 nahm Schmidt eine zweiwöchige Auszeit. Danach begannen seine Einschaltquoten stetig zu steigen. Im Lauf der nächsten zwei Jahre verbesserten sie sich von ca. einer auf eineinhalb Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern stieg auf für Sat.1 hervorragende 18 %. Harald Schmidt heimste nun unzählige Fernsehpreise ein, in manchen Monaten fast jede Woche einen. Zu den Auszeichnungen der Show gehörten der Grimme-Preis 1997 und der Deutsche Fernsehpreis 2000 (Beste Comedy-Sendung/Beste Moderation Unterhaltung), 2001 (Beste Unterhaltungssendung/Beste Moderation Unterhaltung) und 2003 (Beste Comedy-Sendung).
Die einstündige Late-Night-Show lief in der Anfangsphase für kurze Zeit fünfmal pro Woche, dienstags bis samstags nach 23.00 Uhr, dann sieben Jahre lang dienstags bis freitags (die Donnerstagsshow kam bis Ende 1996 eine Stunde später, weil Margarethe Schreinemakers für Schreinemakers live einen Vertrag über eine dreistündige Sendezeit bis Mitternacht hatte). Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs führte Schmidt im Juni 2003 wieder eine fünfte wöchentliche Sendung ein, und am 18. September 2003 sendete Die Harald Schmidt Show um 20.15 Uhr ihr erstes Primetime-Special „Zu Gast auf Vater Rhein“ vier Stunden lang vom Deck des Schiffs „MS Loreley“. Die Sendung floppte in jeder Hinsicht – aber egal: Schmidt hatte seit geraumer Zeit Narrenfreiheit genossen und konnte tun und lassen, was er wollte.
Am 4. Dezember 2003 wurde Sat.1-Chef Martin Hoffmann gefeuert, ein Freund und Förderer Schmidts, der ihm über Jahre diese Narrenfreiheit gewährt hatte. Schmidt bedauerte den Rauswurf am gleichen Abend in seiner Sendung, erklärte jedoch, er sei ja eine Mediennutte („Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“) und werde jetzt eben dem neuen Chef dienen. Vier Tage später zeigte sich, dass Schmidt nichts ferner liegt als das: Er gab bekannt, er werde seine Show im neuen Jahr nicht fortsetzen und wolle eine „kreative Pause“ einlegen (auch dieser Ausdruck wurde zum geflügelten Wort). Die letzte reguläre Show am 23. Dezember 2003 (Folge 1374) erreichte die bis dahin höchste Einschaltquote. Sechs Tage später lief noch ein zweistündiges (schon lange vorher geplantes und aufgezeichnetes) Primetime-Special, das aufs Jahr zurückblickte, im Januar 2004 außerdem noch die im November aufgezeichnete Show „20 Jahre Sat.1″, die Schmidt und Andrack moderierten. Anfang 2004 wiederholte Sat.1 vier Wochen lang „die legendären Sendungen“.
Als Nachfolgerin von Schmidt präsentierte Sat.1 einige Wochen nach dessen Abschied Anke Engelke, die im Mai 2005 erstmals mit Anke Late Night auf Sendung ging und an der unerfüllbaren Aufgabe scheiterte. Schmidt trat mehrmals mit Bühnenversionen seiner Show auf und kehrte Ende des Jahres zurück zur ARD, wo seine Sendung schlicht Harald Schmidt hieß.
Die Hausmeisterin
1987–1992 (ARD). 23-tlg. dt. Familienserie von Cornelia Willinger.
Martha Haslbeck (Veronika Fitz) lässt sich nach 25 Jahren Ehe von ihrem ebenso bequemen wie untreuen Gatten Josef (Helmut Fischer) scheiden und übernimmt in dem Mietshaus im Münchner Stadtteil Haidhausen, um das sie sich ohnehin schon die ganze Zeit kümmerte, nun auch offiziell die Hausmeisterstelle. Josef heiratet seine schnippische Geliebte Ilse Kugler (Ilse Neubauer), Martha bandelt mit dem griechischen Schlosser Costa Doganis (Janis Kyriakidis) an, und Marthas und Josefs Tochter Christa (Bettina Redlich) ist mit Bertl Gruber (Ernst Cohen) zusammen und heiratet ihn später. Zwar verkrachen sie sich regelmäßig, versöhnen sich aber immer wieder. Gleiches gilt für „Josef-Bärli“ und „Ilse-Hasi“.
Ilses größtes Problem ist, dass Josef noch immer an Martha hängt und an allem, was mit ihr zu tun hat. So versucht er zu verhindern, dass Martha das alte Ehebett ausrangiert. An so einem Bett hängen schließlich tausend Erinnerungen, z. B. seine Nierenbeckenentzündung 1964. Um zusätzliches Geld zu verdienen, nimmt Martha mehrere Nebenjobs an, arbeitet erst in einer Tankstelle, dann im Frisörsalon und schließlich im Bürgerbüro. Hauptsächlich kümmert sie sich weiterhin um die Familie und die Hausbewohner: die Ehepaare Ostermeier (Sarah Camp und Hans Stadlbauer) und Merkel (Toni Netzle und Gerd Lohmeier), die Witwe Mooseder (Maria Singer), Herrn Wegmann (Gert Burkhard) und den Rheinländer Rüdiger Münchwieler (Jochen Busse). Das Haus gehört Frau Winter (Erika Wackernagel), ihr Neffe Gerhard Eggerer (Gerhard Zemann) erbt es im Herbst 1989. Giancarlo (Aurelio Ferrara) ist der Wirt von Marthas Stammkneipe, Angerer (Willy Harlander) der Postbote.
Auch Josef schlägt sich mit verschiedenen Jobs durch, fühlt sich aber nur wohl, wenn er gar nichts tun muss, und legt sich bei Bedarf ein Leiden zu. Ins Geschäft kommt er mit seinem alten Freund, dem Antiquitätenhändler Schorschi Gruber (Hans Brenner), dem er fortan irgendwelches Gerümpel ankarrt, das Schorschi dann versteigert. Ilse leitet eine Bank. Christa und Bertl bringen in der letzten Staffel Sohn Seppi (Christoph Dirscherl) zur Welt. Costa und Martha erfüllen sich einen Traum und kaufen sich ein beschauliches Häuschen auf dem Land, vermissen dann aber den gewohnten Trubel und ziehen zurück in das Mietshaus.
Helmut Fischer spielte im Wesentlichen wieder die Rolle, die ihn als Monaco Franze berühmt gemacht hatte. Die einstündigen Serienfolgen liefen im regionalen Vorabendprogramm. 1990 erhielt die Serie den Grimme-Preis mit Bronze. Sie ist komplett auf DVD erhältlich.
Die himmlische Joan
2004–2005 (Pro Sieben). US-Familienserie von Barbara Hall („Joan Of Arcadia“; 2003–2005).
Vater Will Girardi (Joe Mantegna) ist der örtliche Polizeichef in Arcadia, Mutter Helen (Mary Steenburgen) arbeitet im Büro des Schuldirektors, und Tochter Joan (Amber Tamblyn) spricht mit Gott. In immer anderer, aber stets menschlicher Form erscheint Gott der 16-Jährigen und erteilt ihr Aufträge. Mal ist er ein gutaussehender Teenager, mal ein Müllmann und mal die Dame von der Essensausgabe in der Schulkantine. Gott legt ihr nahe, sich einen Job als Aushilfe in einem Buchladen zu suchen oder sich einfach in der Schule mehr anzustrengen. Was das soll, wird zunächst nicht klar. Doch eine Verkettung von Umständen führt immer zu einer positiven Entwicklung, durch die Will einen gesuchten Mörder festnehmen kann oder Joans älterer Bruder Kevin (Jason Ritter) den Lebensmut zurückgewinnt. Dieser sitzt seit einem Autounfall im Rollstuhl und tut sich anfangs schwer, nicht aufzugeben. Joans jüngerer Bruder Luke (Michael Welch) ist ein sarkastischer Wissenschaftsfreak, der für alles eine logische Erklärung findet.
Mary Steenburgen ist die Ehefrau von Ted Danson (Cheers; Becker), Jason Ritter der Sohn von John Ritter (Herzbube mit zwei Damen; Meine wilden Töchter).
Die einstündigen Folgen liefen samstagnachmittags. Pro Sieben zeigte nur die erste von zwei Staffeln.