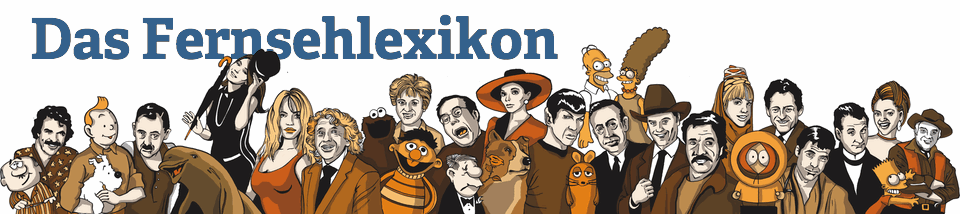Heute Abend wird Sabine Christiansen zum letzten Mal Sabine Christiansen moderieren.
Wer hoffte, noch ein letztes Mal erleben zu können, wie sie sich in der Vorstellung ihrer Gäste verheddert, einen „lustigen“ Filmbeitrag anmoderiert, die Beine übereinander schlägt, über ihre Brille blickt, die Fragen auf ihren Kärtchen einstudiert, während ihre Gäste reden, um sie dann auswendig zu stellen, egal, ob sie gerade passen oder nicht, und egal, ob sie schon in anderem Zusammenhang beantwortet wurden oder nicht, ihre Gesprächspartner immer dann unterbricht, wenn es endlich interessant wird, und wir am Ende alle keinen Deut schlauer sein werden, wird teilweise enttäuscht. Statt der üblichen munteren Stammtischrunde mit Guido Westerwelle und Jürgen Falter hofiert Sabine Christiansen heute den Mann, der laut Moderationskärtchen wohl das Staatsoberhaupt sein muss, und der ist selbstverständlich der einzige Gast.
Es ist schade, dass Horst Köhler, der sich sonst gern ziert, Dinge zu unterschreiben, ausgerechnet den Gästevertrag für Sabine Christiansen doch unterschrieben hat. Der Mann hat Besseres verdient. Und weil wir Fernsehzuschauer das auch haben, erwartet uns ab Herbst Anne Will mit Anne Will, die seit der Will-Kür am 5. Februar als Christiansen-Nachfolgerin feststeht und heute im Anschluss an Sabine Christiansen ihre letzten Tagesthemen moderiert.
Sie werde die Hektik vermissen, die in der Aktuell-Redaktion aufkam, wenn sich die Nachrichtenlage kurzfristig veränderte, sagte Anne Will in einem Interview zum Tagesthemen-Abschied. Wieso? Hat sie etwa vor, ihre neue Talkshow auf die gleiche Weise wie ihre Vorgängerin anzugehen, deren Thema völlig unabhängig von der aktuellen Nachrichtenlage immer „Steht Deutschland am Abgrund?“ war? Immerhin wird Anne Will im Gegensatz zu Sabine Christiansen nicht mehr in der ARD-Abteilung „Unterhaltung“, sondern in der „Information“ angesiedelt sein.
Die ARD-Homepage freilich listet bereits Sabine Christiansen in der Navigation unter der Kategorie Information. Dort ist allerdings auch Nashorn, Zebra & Co. gelistet, was legitim ist, denn der Informationsgehalt beider Sendungen ist etwa gleich hoch.
Zum Abschied noch einmal eine Liste der 25 schönsten Themen aus Sabine Christiansen:
• „Adé Deutschland – Immer mehr Deutsche wandern aus“
(21. Juni 1998)
• „Schule, Uni, arbeitslos – Versagt unser Bildungssystem?“
(18. Juli 1999)
• „10 Jahre Wende – Frust ohne Ende?“
(26. September 1999)
• „Spitzentreffen – Wieviel Zukunft hat Deutschland?“
(29. Oktober 2000)
• „Steht der Osten auf der Kippe?“
(4. März 2001)
• „Wie krank ist Deutschland?“
(1. Juli 2001)
• „Polit-Gipfel: Wie kommt Deutschland aus der Krise?“
(25. November 2001)
• „Armes Deutschland – Bloß verwaltet, nicht gestaltet?“
(2. Dezember 2001)
• „Blauer Brief & rote Zahlen! Deutschland unter Druck“
(3. Februar 2002)
• „Korruption und Stillstand – wie kaputt ist Deutschland?“
(10. März 2002)
• „Wohin rollt der Ball – Deutschland AG vor dem Abstieg?“
(7. April 2002)
• „Wirtschaftsflaute, Streik – Bleibt Deutschland Schlusslicht?“
(5. Mai 2002)
• „Deutschland in Not: Krisen und keine Konzepte?“
(10. November 2002)
• „Neues Jahr, neue Chance: Kommt Deutschland endlich aus der Krise?“
(12. Januar 2003)
• „Ausbildungsmisere – Wer bietet jungen Menschen noch eine Chance?“
(27. Juli 2003)
• „Gewerkschaften, Beamte, Politiker – wer blockiert das Land?“
(31. August 2003)
• „Land ohne Kinder – Land ohne Zukunft?“
(7. September 2003)
• „Macht dieses Steuersystem Deutschland kaputt?“
(12. Oktober 2003)
• „Deutschland bankrott – Euro in Gefahr?“
(30. November 2003)
• „Europa bewegt sich – wer bewegt Deutschland?“
(2. Mai 2004)
• „Deutschlands Jugend – viele Chancen, wenig Perspektiven?“
(10. Oktober 2004)
• „Für ein paar Kröten arbeiten – Jobs nur noch zu Dumpingpreisen?“
(17. April 2005)
• „Koalition der leeren Kassen – Wer zahlt die Zeche?“
(23. Oktober 2005)
• „Steuer-Staat Deutschland: Fass ohne Boden“
(24. September 2006)
• „Abstrampeln für Nichts – Lohnt sich Leistung noch?“
(29. Oktober 2006)
Michael, 24. Juni 2007, 06:57.