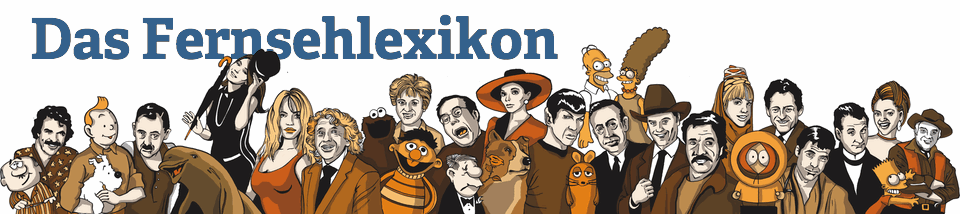Foto: Pro Sieben.
Immerhin wissen wir nun, dass die Antwort „Im Prinzip Ja“ lautet. Die Antwort auf die Frage, ob es möglich ist, eine Castingshow zu produzieren, die im Gegensatz zu Deutschland sucht den Superstar grundsätzlich menschenfreundlich ist, ohne so langweilig zu sein wie Gottschalks Musical Showstar 2008.
Bully sucht also Leute, die in seiner Verfilmung von Wickie und die starken Männer, die 2009 ins Kino kommen soll, Gorm, Urobe, Ulme, Faxe, Tjure und Snorre spielen. Was die Voraussetzungen sind, ist nicht ganz klar; irgendeine äußerliche Ähnlichkeit ist offenbar hilfreich, aber nicht notwendig, dasselbe gilt für schauspielerisches Talent. Gute Typen sind gesucht, und einige haben sich auch zum Vorsprechen beworben.
Da ist Alexander Mayer, ein junger Bayer, der in Tracht gekommen ist und in breitem Bayerisch spricht, aber behauptet, hochdeutsch nicht nur sprechen zu können, sondern gelegentlich sogar zu denken (was sich spontan aber nicht überprüfen lässt). Er ist sensationell sympathisch, halbfreiwillig komisch — nur der Gedanke, ihn als Schauspieler zu engagieren, drängt sich nachhaltig nicht auf. Es ist herzzerreißend, seine ungläubige Enttäuschung zu sehen, als er erfährt, dass es nichts wird mit der Rolle. Das ist besonders tragisch, denn Alexander sagt: „Bully, ich glaub, ich bin dein größter Fan.“ Andererseits ist er deshalb schon grenzenlos glücklich, Bully überhaupt getroffen haben zu dürfen. Ein Autogramm wünscht er sich noch. Bully will es ihm auf den Wikingerhelm schreiben, den Alexander mitgebracht hat und aufgeregt zwischen den Fingern dreht, bloß: „Des is aber ein Leihhelm…“ Es findet sich schließlich ein Poster, das er unterschrieben mitnehmen kann, und als Alexander auch von Jürgen Vogel ein Autogramm bekommt, sagt er dem Schauspieler noch, fast als wollte er ihn trösten: „Ich find dich auch klasse.“
Aus ganz Deutschland sind sie angereist für dieses Casting, aber es liegt eine angenehm entspannte Atmosphäre über dem Ganzen: dass es hier nicht darum geht, Deutschlands nächster Super-Wikinger zu werden oder sich ein Lebensziel zu erfüllen, für das man seit seiner Geburt Gesangstunden nimmt. Es ist eine unverhoffte Chance, ein wunderbarer Traum, nicht mehr und nicht weniger.
In kleinen Rollenspielen müssen sich die Kandidaten präsentieren, und dass die meisten von ihnen bessere Selbstdarsteller als Anderedarsteller sind, tut der Unterhaltsamkeit keinen Abbruch. Viele kleine Männer sind gekommen (manche scheinen sogar noch kleiner zu sein als Jürgen Vogel) und bewerben sich darum, als Snorre groß rauszukommen. Aber auch für langsame, tumbe, lange und alte Bewerber bietet das zu castende Wikinger-Ensemble ja Chancen. Außer Bully und Jürgen Vogel sitzt ihnen die Produzentin Rita Serra-Roll gegenüber, und gemeinsam zeigt die Jury nicht nur gelegentlich eine unerklärliche Großzügigkeit, was das Verteilen von Helmen angeht, die zur Teilnahme am „Recall“ berechtigen, sondern auch eine wunderbare Dankbarkeit für unbrauchbare, aber unterhaltsame Vorstellungen, die sie hier sehen. „Das war ’ne schöne Lebenszeit“, sagt Jürgen Vogel einmal.
Bully sucht die starken Männer wäre, mit anderen Worten, eine anständige, teilweise fast zarte Show geworden — wenn sie nur (höchstens!) halb so lang gewesen wäre und die Produzenten allein der Kraft dieser Casting-Auftritte vertraut hätten. Leider versucht ein nerviger Off-Sprecher, eine offenkundig nicht vorhandene Dramatik in die Szenen zu quatschen, und zwischendurch gibt es immer wieder Promotion-Szenen für den Film und Ausschnitte vom konventionell veranstalteten Kindercasting für die Hauptrolle des Wickie, die ebenso lang wie weilig sind. Am Ende bewirbt sich „überraschend“ noch Günther Kaufmann um die Rolle des Faxe, wird aber abgelehnt und ist schon halb zur Tür raus, als ihm Bully plötzlich in Zeitlupe verspricht, stattdessen aber die Rolle des schrecklichen Sven spielen zu dürfen.
Das hätt’s wirklich nicht gebraucht.
Stefan, 16. April 2008, 00:31.