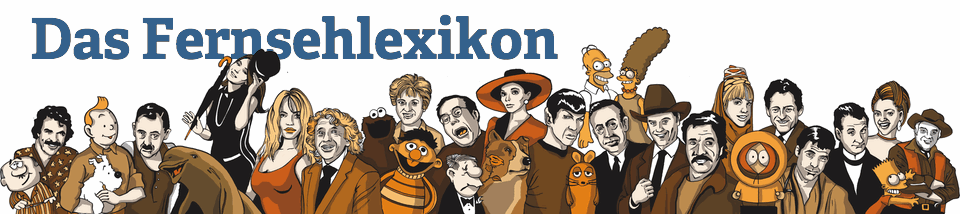Alles Glück dieser Erde
1994 (ARD). 13-tlg. dt. Pferde-Soap von Friedrich Werremeier, Regie: Michael Werlin.
Im Münsterland liegt die Pferdezucht des alten Jakob Eicke (Rolf Hoppe), der zwei ungleiche, miteinander verfeindete Söhne hat. Der ältere ist Werner (Rüdiger Kirschstein). Er muss den maroden Hof führen und hinkt seit einem Reitunfall, den sein Bruder verschuldet hat. Stefan (Michael Roll) dagegen darf lustwandeln, Springreitturniere gewinnen und Frauen wie Gräfin Gabriella „Gipsy“ von Bovens (Carolina Rosi) erobern, die eine direkte Konkurrentin des Eicke-Hofs ist. Stefans Konkurrent auf dem Parcours ist Renato Tucci (Lorenzo Quinn). Pferde werden entführt und gedopt, Menschen ermordet, bestochen, verraten und betrogen, und Pfarrer Lucas Delbrück (Hanns Zischler) geht fremd.
Black Beauty für Erwachsene. Mit der ZDF-Primetime-Soap Rivalen der Rennbahn hatte diese Variante natürlich nichts zu tun. Hier ging es ja ums Springreiten.
Nach einem Pilotfilm am Donnerstag liefen die 50-minütigen Folgen dienstags um 20.15 Uhr. Zur Serie erschien ein Roman von Richard Mackenrodt.
Alles Gute, Köhler
1973 (ZDF). 7-tlg. dt. Problemserie von Sina Walden und Stefan Rinser.
Gerhard Köhler (Herb Andress) saß wegen eines Raubüberfalls vier Jahre im Gefängnis und wird nun auf Bewährung entlassen. Er geht zunächst zurück in seinen Heimatort, stößt dort aber auf viele Probleme. Seine Frau (Corny Collins) hat sich von ihm scheiden lassen, und sowohl beruflich als auch privat wird er immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert, die einen Neuanfang fast unmöglich machen, auch später in der Großstadt.
Die Serie aus der evangelischen Redaktion lief in dreiviertelstündigen Folgen montagabends und war ein unerwarteter Erfolg bei den Zuschauern. Am Ende jeder Folge diskutierten und kommentierten ein Strafanstaltsleiter und eine Bewährungshelferin das Geschehen.
Alles hat ein Ende, nur Bienzle hat zwei
So muss ein großes Finale aussehen! Der letzte Tatort mit dem Stuttgarter Kommissar Bienzle hatte alles, was man für ein würdiges Ende einer Reihe benötigt. Zum Schluss wurde es noch einmal spannend (mit „Schluss“ meine ich hier natürlich nicht den ganzen letzten Film, sondern nur die letzten fünfzehn von neunzig Minuten, denn wir sprechen schließlich trotz allem noch immer von Bienzle — da die Verwendung des Begriffs „spannend“ im Zusammenhang mit Bienzle bisher landläufig als Oxymoron galt, ist das schon enorm), Bienzle macht seiner großen Liebe Hannelore endlich einen Heiratsantrag, und sie nimmt ihn am Ende auch noch an, und zwischendurch schenkt man dem ebenfalls scheidenden SWR-Intendanten Peter Voß auch noch einen Gastauftritt als Polizeipräsident. Wie gesagt: Ein schöner Abschluss der Bienzle-Ära.
Wenn mir jetzt noch jemand einleuchtend erklären könnte, warum dieser zuletzt geschriebene und zuletzt gedrehte Bienzle-Tatort, dieses große Finale, nicht auch zuletzt gezeigt wird, sondern noch eine weitere Erstausstrahlung im Februar folgt, wäre das echt ganz, ganz toll.
Alles klar?!
1978–1983 (ARD). Jugendtalkshow mit Uschi Schmitz. Live diskutiert sie mit Jugendlichen über Themen, die diese selbst vorgeschlagen haben. Es geht um Eltern und Schule, Gesellschaft und Politik, Mode und Liebe und natürlich Sex.
Die Sendung sah aus, wie man sich eine Diskussionssendung der 70er Jahre vorstellt: Die Moderatorin trug Indienkleider und lümmelte oder kniete mit den Jugendlichen auf einem Flickenteppich oder auf Kissen. Nur die Erwachsenen (meistens die Eltern) saßen auf Holzhockern. Die Zuschauer konnten anrufen; was sie gesagt hatten, berichteten Redakteure am Ende der Sendung. Kein Wunder, dass so ein unzensiertes Forum für Jugendliche Proteste auslöste: Am 2. März 1979 führte die Folge „Auch Fummeln muss man lernen“ zu Kritik in katholischen Kreisen Bayerns. Das Motto der Sendung sei „geschmacklos und uneinsichtig“ und widerspreche einer „verantwortbaren, auf verbindliche Werte und Wertungen gegründeten Sexualerziehung“. Die Absetzung der Sendereihe wurde gefordert — vergeblich. Auch eine Folge über Selbstmord erregte Anstoß. Insgesamt war der Talk aber nicht so revolutionär, wie man glauben könnte: Die Jugendlichen, die meist aus der Mittelschicht stammten, diskutierten brav miteinander.
Nach den Worten von Uschi Schmitz wurde Alles klar?! schließlich abgesetzt, um den Freitagnachmittag, an dem die Sendung monatlich lief, „familienfreundlicher“ zu gestalten. An ihrer Stelle liefen dann also Tierfilme und Kinokomödien.
Alles Lisa
Seit Lisa Plenske wieder da ist, haben sich die Einschaltquoten von Verliebt in Berlin erkennbar erholt. Das dürfte Sat.1 Hoffnung geben für den Serienstart von Alles Betty am Freitag, der amerikanischen Version derselben Serie, auf der auch Verliebt in Berlin basiert. (Ausführliche Besprechung dann an dieser Stelle.)
Wenn allerdings die US-Version mit dem bescheuerten deutschen Titel ebenfalls einigermaßen beim Publikum ankommt, ist zu befürchten, dass Sat.1 demnächst auch noch die bereits existenten Adaptionen der Serie aus Indien, Israel, Russland, der Türkei, Mexiko, den Niederlanden und Spanien sowie das Original aus Kolumbien zeigen wird und derweil hofft, dass bald noch ein paar weitere Länder liefern können.
Alles mit Musik
1983 (ZDF). Kurzlebiges Musikquiz mit Hans Rosenthal und dem Horst Jankowski Quartett.
Sechs Kandidaten aus dem Publikum müssen in drei Runden verschiedene Musiktitel erraten: Mal geht es um Schnelligkeit, mal darum, alle Musiktitel zu erkennen, die in einer Geschichte versteckt sind, die ein Prominenter vorliest.
Das Spiel war 30 Minuten lang, lief dienstags um 17.50 Uhr und brachte es auf nur drei Ausgaben. Ein Jahr später lief eine Nachfolgesendung unter dem Titel Musik macht Spaß.
Alles nichts oder?!

Foto: RTL
1988–1992 (RTL). „Ein Spiel mit W(T)orten“. Einstündige Klamaukshow mit Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen. Prominente Gäste bestreiten irrwitzige Spiele, und am Ende fliegen Torten.
Die Show war ein ausgelassener Kindergeburtstag für Erwachsene: Je ein prominenter Gast, im letzten Jahr der Show mehrere, wird durch diverse Wort- und Aktionsspiele geschleift. Die Spiele wechseln, doch viele tauchen immer wieder auf: Es müssen Gegenstände erinnert, Zungenbrecher mit einem Tischtennisball im Mund aufgesagt oder von Balder und von Sinnen gesungene Melodien erraten werden. Ein vom Gast erzählter Witz muss von Balder in einer vorgegebenen Zeit nacherzählt werden, allerdings inklusive mehrerer Begriffe, die vorab auf Zuruf aus dem Publikum gesammelt wurden. Auch klassische Partyspiele sind dabei, teils leicht abgewandelt. Beim Kofferpackspiel werden reihum imaginäre Gegenstände eingepackt, die in der richtigen Reihenfolge aufgesagt und mit einer Geste verdeutlicht werden müssen (Hugo packt gern einen Kondomautomaten ein). In „Kommando trommele“ reißen Moderatoren, Promis und ausgewählte Zuschauer nach dem „Alle Vögel fliegen hoch“-Prinzip die Arme hoch, wenn etwas genannt wird, das tatsächlich fliegen kann. Währenddessen tragen alle ein lustiges Hütchen. Beim Telefonspiel hat der Prominente die Aufgabe, einen zufällig aus dem Telefonbuch ausgewählten Menschen anzurufen und davon zu überzeugen, dass er wirklich dran ist. Im später eingeführten „Spiel-Spiel“ zum Schluss stehen der Gast und einer der Moderatoren auf einem überdimensionalen Spielfeld und würfeln die Felder aus, die sie vorrücken durften, während der andere Moderator absurde Aufgaben stellt.
Der Verlierer jedes Spiels, also entweder die Moderatoren oder der Gast, bekommt eine Torte. Der Gesamtverlierer muss am Ende seinen Kopf durch eine Wand stecken und sich mit den erspielten Torten bewerfen lassen. Das sind in der Regel Balder und von Sinnen selbst, weil sie vorher bei der Punktevergabe großzügig waren (sicher konnten die Prominenten dennoch nicht sein, verschont zu bleiben: z. B. Wolfgang Völz, Jürgen von der Lippe, Klaus & Klaus und Harald Schmidt mussten hinter die Tortenwand). Der Gast gibt dann das Kommando zum Tortenwerfen an Leute aus dem Studiopublikum. Zuvor hält er den Moderatoren für „letzte Worte“ das Mikrofon unter die Nase. Mindestens einmal pro Sendung pirscht sich von Sinnen an die Kamera heran und tanzt „Tschaka-Tschaka“, was wohl mal als Überbrückung zwischen Spielen oder Umbauphasen gedacht war, aber nicht wirklich einen Grund benötigte. Sie wackelt mit dem Kopf und singt dazu: „Tschaka, tschaka, tschaka, tschaka …“
Das Angebot, ihre neue Single zu singen, hätten die meisten prominenten Gäste besser ablehnen sollen. Bei einigen war das Playback manipuliert, Roberto Blanco musste mit verbundenen Augen singen und dabei mehrere Cocktails erkennen. Neben den Spielen gab es viel Situationskomik mit dem ungleichen Moderatorenpaar, das sich siezte, mit „Herr Balder“ und „Frau von Sinnen“ ansprach und permanent anzickte („Sie magersüchtiges Frettchen“ — „Sie fette Schnecke“). Hella von Sinnen trug in jeder Sendung ein anderes irrwitziges, meist sehr ausladendes Kostüm. Sie trat u. a. als Freiheitsstatue, weißer Hai und Badezimmer inklusive Waschbecken vor der Brust auf. In der letzten Sendung 1992, der 100., trat Hella von Sinnen erstmals in normaler bequemer Kleidung auf, dafür trug Hugo Egon Balder ein Wolfskostüm. Am Ende dieser letzten Show sang Frank Zander auf die Melodie von Rod Stewarts „Sailing“: „Nur nach, nur nach Hause, nur nach Hause gehen wir nicht.“
Die Show lief zunächst freitags gegen 23.00 Uhr, ab Juli 1988 samstags nach dem Hauptabendprogramm gegen 22.00 Uhr. Autor der Sendung war Klaus de Rottwinkel, der auch die Spiele für Geld oder Liebe erfand.
Alles o. k., Corky
1993–1994 (ARD). 22-tlg. USFamilienserie von Michael Bravermann („Life Goes On“; 1989).
Charles „Corky“ Thatcher (Christopher Burke) ist ein 18-jähriger Junge mit Downsyndrom, der nach Jahren auf Spezialschulen für Behinderte auf eine reguläre Highschool wechselt und sich auch sonst bemüht, ein „normales“ Leben zu führen. Dabei unterstützt ihn seine Familie: die Eltern Drew (Bill Smitrovich), ein früherer Bauarbeiter, der nun ein Restaurant führt, und Libby (Patti LuPone), eine ehemalige Sängerin, die in der Werbung arbeitet, sowie Corkys jüngere Schwester Rebecca, genannt Becca (Kellie Martin), mit der er in eine Klasse geht. Auch Paige (Monique Lanier), Drews Tochter aus erster Ehe, zieht nach einer gescheiterten Beziehung wieder bei den Thatchers ein.
Alles o. k., Corky war die erste amerikanische Serie, die sich um einen geistig behinderten Hauptdarsteller drehte — in Nebenrollen waren Behinderte allerdings z. B. schon in L.A. Law regelmäßig zu sehen gewesen. Schauspieler Christopher Burke, der für die Rolle einen Emmy bekam, hat selbst das Downsyndrom. Das Leben mit Behinderung war allerdings keineswegs das einzige Thema der Serie, die realistisch, aber positiv und nicht problemüberladen war: Außer um Corkys Kampf um Anerkennung ging es auch um die alltäglichen Probleme der anderen Familienmitglieder.
In den USA liefen insgesamt vier Staffeln mit 83 Episoden. Die Titelmusik ist der Beatles-Song „Ob-La-Di, Ob-La-Da“, gesungen von Patti LuPone und den anderen Schauspielern. In der ARD wurden die jeweils einstündigen Folgen im regionalen Vorabendprogramm gezeigt.
Alles oder nichts
1956–1988 (ARD). 45-minütiges Quiz.
Kandidaten spielen in von ihnen bestimmten Wissensgebieten um einen Geldgewinn. Mit jeder richtig beantworteten Frage verdoppelt sich der gewonnene Betrag. Der Kandidat kann nach jeder Frage mit dem bis dahin gewonnenen Geld aussteigen; macht er jedoch weiter und gibt eine falsche Antwort, ist das Spiel für ihn zu Ende und das gesamte Geld verloren.
Einzelheiten des Spielkonzepts, Regeln, Gewinnhöhe, Sendeplatz, Moderator, alles änderte sich im Lauf der Zeit mehrfach, doch insgesamt war Alles oder nichts mit einer Laufzeit von mehr als 30 Jahren eine der langlebigsten Sendungen im deutschen Fernsehen. Vorbild war das US Quiz „The 64 000 $ Question“, in der deutschen Version bedeutete „Alles“ aber nur einen Bruchteil. Der Höchstgewinn lag anfangs bei 4000 DM und steigerte sich mit den Jahrzehnten auf 16 000 DM.
Moderator war in den ersten Jahren Heinrich Fischer, und die Show lief im regionalen Vorabendprogramm. Im Herbst 1957 wurde sie erstmals in die Primetime übernommen, aber nur für zwei Monate. Es spielte jeweils ein Kandidat allein in seinem Gebiet. Um Themenvielfalt zu gewährleisten, bestritt er jedoch nicht alle Runden hintereinander weg, sondern beantwortete immer nur wenige Fragen am Stück. Dann kamen andere Kandidaten mit ihrem Gebiet an die Reihe. Auf diese Weise wurden Publikumslieblinge aufgebaut, die in der nächsten Sendung wiederkamen, um dort anzuknüpfen, wo beim letzten Mal die Sendezeit um war.
Nach einer kurzen Pause wurde 1963 Wolf Schmidt, der als Papa der Familie Hesselbach berühmt geworden war, der Quizmaster einer neuen Staffel mit dem erhöhten Hauptgewinn von 6000 DM. Im Februar 1966 verlegte die ARD das Quiz endgültig in die Primetime, jetzt mit Dr. Georg Böse, doch zunächst ohne Erfolg.
Vom 10. Dezember 1966 bis 3. Dezember 1971 moderierte Erich Helmensdorfer 61 Ausgaben und machte die Show und sich selbst zum Publikumsliebling. Er hatte zuvor als politischer Journalist und Sprecher der heute-Nachrichten beim ZDF gearbeitet und wurde für seine neue Tätigkeit als Quizmaster mit Lob überschüttet. Dabei gab er den strengen, ungeduldigen Prüfer, der vor allem bei der schwierigen Finalfrage rigoros die Antworten einforderte und keine Extrabedenkzeit gestattete. Bei der letzten Aufgabe, die zu dieser Zeit 8000 DM wert war, standen jedem Kandidaten sechs Minuten reine Bedenkzeit zu, die er beliebig einteilen konnte und die immer angehalten wurde, wenn er eine Antwort gab. Zögerte er während einer Antwort, stellte Helmensdorfer fest: „Er denkt“ und ließ die Uhr weiterlaufen.
Schwierigkeitsgrad und Umfang der Fragen steigerten sich bis zur Schlussrunde analog zum möglichen Gewinn. Es begann mit Einzelfragen zur Allgemeinbildung, die unter Umständen auch ein Laie hätte beantworten können, und endete mit mehrteiligen Aufgaben („Sie sehen es, die Frage hat 33 Teile, und Sie sollen 28 davon beantworten“), bei denen das Publikum, je nach Fachgebiet, nicht einmal im Ansatz begreifen konnte, worum es eigentlich ging. („In welchen Gebieten des Milchstraßensystems und unter welchen Voraussetzungen konnte man die örtliche Verteilung der galaktischen Rotationsgeschwindigkeit aus Radiomessungen bestimmen?“ war nur eine der 33 Teilfragen zum Thema „Astronomie“).
Die Kandidaten saßen in den letzten Runden in einer schalldichten Kabine, damit sie sich besser konzentrieren konnten, und erhielten die Fragen schriftlich zum Mitlesen. Rückfragen waren gestattet, beantworten konnte sie Helmensdorfer jedoch meistens nicht („Also, in meinen Augen ist das schlüssig“). Er selbst hatte sich zwar in den Wochen vor der jeweiligen Sendung intensiv auf die Fachgebiete vorbereitet und sich schulen lassen, doch verstand er noch immer erkennbar weniger als seine Kandidaten, die nun einmal Experten waren. Richtig war deshalb nicht, was die Kandidaten mitunter plausibel erklärten, sondern was auf Helmensdorfers Karteikarten stand bzw. auf der großen Antworttafel, die für die Zuschauer sichtbar war.
Sendeplatz war montags um 21.00 Uhr. Einige Kandidaten wurden durch den Hauptgewinn so populär, dass die ARD sie in ganzen Sondersendungen porträtierte. Andere waren gar nicht so scharf auf den Gewinn. Eine Kandidatin hatte bereits 4000 DM gewonnen, kam aber nicht wieder, weil sie vor der nächsten Sendung einen Millionär geheiratet hatte. Der wollte nicht den Eindruck erwecken, seine Frau sei an 8000 DM interessiert.
Helmensdorfers Nachfolger wurden Dr. Andreas Grasmüller und ein Affe. Der Schimpanse Toni war mit einer bayerischen Lederhose bekleidet und loste den Gewinner einer Zuschauerfrage aus. Beide blieben nur kurze Zeit. Anschließend moderierte bis zum 25. Juni 1981 Günter Schramm. Der Gewinn wurde wieder erhöht, und es kamen moderne Monitore dazu, von denen die Kandidaten nun die Fragen ablesen konnten. Der Sendeplatz wurde 1980 auf 21.45 Uhr am Donnerstag verlegt; nach massiven Zuschauerprotesten, das sei viel zu spät, wurde das Quiz aber wieder um 21.00 Uhr ausgestrahlt.
Mit dem letzten Moderator Max Schautzer wurde der Modus geändert und jede Sendung unter ein einzelnes Oberthema gestellt. Jetzt bewarben sich nicht mehr Kandidaten mit ihrem Fachgebiet, stattdessen wurde das Thema vorgegeben, zu dem Schautzer dann zu Bewerbungen aufrief. Zu diesem Thema spielten nun in einer Vorrunde zwei Kandidaten gegeneinander, eine wechselnd besetzte Expertenjury entschied über die korrekte Beantwortung. Für den Sieger der Vorrunde ging es dann am Spieltisch um alles oder nichts. Wie im Casino schob Schautzer dem Kandidaten Chips mit aufgedruckten Geldbeträgen zu (immer in zwei Währungen: DM und Schilling) und tauschte sie bei korrekter Antwort gegen höhere aus. Ein Ehrengast, wiederum ein Experte, stellte die jetzt nur noch einteiligen Fragen.
Die Show lief nun dienstags um 20.15 Uhr. 1988 wurde sie eingestellt. Im gleichen Jahr startete eine RTL Show, die ihren Titel parodierte: Alles nichts oder?!, aber eben nur den Titel.
Alles typisch
2008 (Sat.1). „Der große Klischee-Test“. Einstündige Abendshow mit Janine Kunze, in der wechselnde Reporter Klischees testen: Kleben bei Kfz-Mechanikern wirklich Bilder nackter Frauen im Spind, tragen Trucker Holzfällerhemden, und spürt ein harter Mann keinen Schmerz? Bei den Tests handelt es sich eher um vermeintlich witzige Stichproben als aussagekräftige Untersuchungen. Anschließend setzen sich die Reporter oder Testpersonen zu Janine Kunze auf die Couch und müssen reden.
Drei Ausgaben liefen freitags um 20.15 Uhr. Weil dann zwar noch produzierte Folgen, aber kaum noch Zuschauer übrig waren, versetzte Sat.1 den Rest ins Sonntagnachmittagsprogramm.