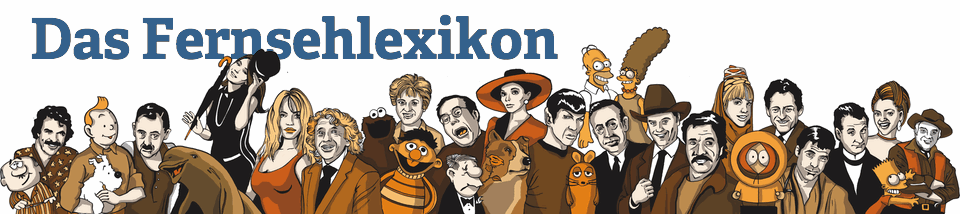Das perfekte Promi-Dinner
Seit 2006 (Vox). Weiterentwicklung des perfekten Dinners mit Prominenten, die sich gegenseitig bekochen und bewerten. Diesmal nicht auf fünf Sendungen verteilt, sondern in einer großen Abendshow zusammengefasst. Die lief am Sonntag und entwickelte sich wie die Werktagsversion vom langsamen Starter zum Erfolg.
Das perfekte Timing
Seit vergangenen Montag zeigt ProSieben werktags seine Dating-Koch-Doku-Soap Liebe isst. Und vermutlich ist es kein Zufall, dass die Sendung nicht nur fast so aussieht wie die erfolgreiche Vox-Sendung Das perfekte Dinner, sondern direkt im Anschluss an Das perfekte Dinner beginnt.
Theoretisch jedenfalls. Praktisch hat Vox die Sendezeit von Das perfekte Dinner unauffällig ein bisschen verändert. Seit vergangenen Montag isst man auf Vox nicht mehr bis 19.45 Uhr, sondern fünf Minuten länger. Gerade so lang, dass es nicht mehr ganz so naheliegend ist, direkt nach dem Ende der Sendung zur ProSieben-Variante umzuschalten.

Nicht dass solche Taschenspielertricks angesichts der Quoten und der Qualität von „Liebe isst“ wirklich nötig gewesen wären. Aber besser isst’s.
Das Quiz mit Jörg Pilawa
Seit 2001 (ARD). Vorabendquiz für Kandidatenpaare mit Jörg Pilawa.
Zwei Freunde, Kollegen, Verwandte oder Ehepartner spielen gemeinsam um Geld. Pilawa stellt zunächst einem von ihnen eine Frage mit vier Lösungsmöglichkeiten. Nachdem dieser seine Antwort gegeben hat, muss sich sein Partner entscheiden, ob er die Antwort stehen lässt oder ein Veto einlegt. In diesem Fall kann er entweder anders antworten oder um eine neue Frage bitten. Insgesamt haben beide nur viermal diese Einspruchmöglichkeit. Der Gewinn erhöht sich mit jeder richtigen Antwort und kann bis auf 500 000 Mark, ab Januar 2002 bis auf 300 000 Euro ansteigen. Vor jedem Spiel dürfen die Kandidatenpaare zwei Beträge festlegen, unter die sie, wenn sie diese einmal erreicht haben, bei falschen Antworten nicht zurückfallen.
Pilawa kam von Sat.1, wo er erfolgreich Die Quiz Show moderiert hatte. Die ARD gab ihrem Neuzugang also ganz originell eine Quizshow auf einem ähnlichen Sendeplatz mit ähnlicher Optik und hoffte, dass die Zuschauer dem neuen Star folgen würden. Und sie taten es! Die Sat.1-Show büßte drastisch Zuschauer ein, das ARD-Quiz wurde sofort ein Erfolg. Die scheinbar kleine Veränderung, das übliche Multiple-Choice-Spiel mit einem Kandidatenpaar zu spielen, brachte tatsächlich einen neuen Reiz in die Sendung: Oft genug verstärkten sich die beiden Spieler nicht; regelmäßig brachte ein dominanter Kandidat, der wenig wusste, aber viel zu wissen glaubte, sich und seinen Partner durch voreilige Vetos um hohe Gewinne.
Das Quiz dauerte zunächst eine Stunde und lief mittwochs bis freitags um 18.55 Uhr. Ab Januar 2002 war die Sendung nur noch halb so lang, kam dafür aber viermal die Woche, dienstags bis freitags um 19.20 Uhr.
Das Sandmännchen
1959–1989 (ARD, Dritte). Fünfminütige Sendung, in der Kindern, kurz bevor sie ins Bett müssen, noch einmal kurze Bildergeschichten gezeigt werden, die ihnen eine freundliche Puppe mitbringt: das Sandmännchen.
Die erste Figur war eine Handpuppe von Johanna Schüppel, die nach einer Idee von Ilse Obrig entwickelt worden war. Inspiriert wurde Obrig dazu durch den Abendgruß im DFF, der damals noch ohne Sandmann auskam und seinerseits auf die DDR-Radiosendung „Abendlied“ zurückging, die wiederum von Obrig erfunden worden war. Als im DFF bekannt wurde, dass im SFB an einer Sandmann-Figur gearbeitet wurde, setzten die Mitarbeiter alles daran, schneller zu sein als die West-Kollegen. Tatsächlich kamen sie ihnen mit Unser Sandmännchen gut eine Woche zuvor und gingen schon am 22.11.1959 auf Sendung. Der West-Sandmann tauchte erstmals am 01.12.1959 auf – allerdings nicht, weil man langsamer arbeitete, sondern weil die Sendung ohnehin erst für die Vorweihnachtszeit vorgesehen war.
Das bekannteste Sandmännchen der Bundesrepublik wurde 1962 von Herbert K. Schulz entwickelt. Er war ein Greis mit Kinnbart, der auf einer Wolke lebte und die Filme mit den Worten ankündigte: „Nun liebe Kinder, gebt fein acht, ich hab’ euch etwas mitgebracht.“ Auch die Verabschiedung war immer gleich: „Auf Wiederseh’n. Und schlaft recht schön.“ Das dazugehörige von Kindern gesungene Lied ist von Kurt Drabek (Musik) und Helga Mauersberger (Text): „Kommt ein Wölkchen ahangeheflogen, schwebt herbei ganz sacht, und der Mond am Hihimmehel droben hält derweil schon Wacht. Abend will es wieder werden, alles gehet zur Ruh, und die Kinder auf der Erden machen bald die Äuhäuglein zu. Doch zuvor von fern und nah ruft’s: Das Sandmännchen ist daaaa.“

Foto: rbb
Richtig glücklich scheint man im Westen mit seinen verschiedenen Sandmännern nicht gewesen zu sein. 1966 versuchte der WDR, den Ost-Sandmann zu kaufen und entwickelte, als das DDR-Fernsehen trotz der verlockenden Devisen ablehnte, einen „Sandmann International“: Eine tanzende und singende Samson-ähnliche Figur, in der eine kleine Frau steckte. Anfang der 80er Jahre entstanden eine ganze Reihe neuer Sandmann-Figuren.
Eine der frühen und beliebtesten Serien, die das Sandmännchen mitbrachte, war „Hilde, Teddy, Puppi“, gespielt von der Augsburger Puppenkiste gemeinsam mit der ersten deutschen Fernsehansagerin Hilde Nocker. Die Puppenkiste lieferte viele hundert weitere Folgen verschiedener Serien. Langlaufende Reihen waren außerdem u.a. „Die Wawuschels“, eine grünhaarige Sippe mit Vater, Mutter, Opa, Onkel und den Kindern Wischel und Wuschel, die in einem dunklen Berg leben, den sie mit ihren Haaren beleuchten, in Eintracht mit ihrem Hausdrachen und in Zwietracht mit dem grimmigen Mamoffel und den Zazischels, und die sich von Tannenzapfenmarmelade ernähren; „Piggeldy und Frederick“, eine Legetrickserie mit einem kleinen und einem großen Schwein, in der das kleine (Piggeldy) seinen großen Bruder Frederick zu allen möglichen Alltagssituationen ausfragt und Frederick alles mit abnehmender Geduld beantwortet (der Off-Sprecher schloss jede Folge mit den Worten: „Und Piggeldy ging mit Frederick nach Hause“), sowie „Cowboy Jim“; „Trixi Löwenstark“; „Käpt’n Smoky“, „Der kleine Pirat“ und „Der Tierbabysitter“.
Das Sandmännchen lief im regionalen Vorabendprogramm ungefähr um 19.00 Uhr. Es erreichte nie die Beliebtheit seines ostdeutschen Vetters und wurde noch vor der Wende unauffällig eingestellt, weil Kinder für das kommerziell orientierte Vorabendprogramm der ARD als Zielgruppe uninteressant waren. Ohnehin hatten verschiedene ARD-Sender das Sandmännchen schon seit längerer Zeit nur noch in ihrem dritten Programm gezeigt.
Das Schwein — Eine deutsche Karriere
1995 (Sat.1). 3‑tlg. dt. Karrieredrama von Karl Heinz Willschrei, Regie: Ilse Hofmann.
Der Berliner Stefan Stolze (als Jugendlicher: Daniel Weiss; später: Götz George) wächst in der schwierigen Nachkriegszeit in Berlin auf. Früh entdeckt er, wie man es im Leben zu etwas bringt. Man benötigt Geld, und daran kommt man durch Intrigen oder Betrug. Schon in der Schule verkauft er seine Hausaufgaben und denunziert einen Lehrer, um seinen Mitschüler Lutz Krüger (als Jugendlicher: Richard Kropf; später: Felix von Manteuffel) vor dem Sitzenbleiben zu bewahren. Später geht er den eingeschlagenen Weg weiter, wird Zuhälter und Hehler und kommt ins Gefängnis. Dort freundet er sich mit Robert Korda (Michael Mendl) an, dessen Firma er sich nach seiner Entlassung auf Bewährung unter den Nagel reißt, indem er Kordas Frau Eva (Edda Leesch) verführt.
Krüger ist inzwischen Filialleiter einer Bank und hilft bei Bedarf mit Krediten, wird später aber auch von Stolze enttäuscht. Um Teil der besseren Gesellschaft zu werden, heiratet Stolze die wenig attraktive Alice van Lück (Andrea Sawatzki). Ihrem Vater Theodor van Lück (Karl-Michael Vogler) gehört ein großer Elektrokonzern. Indem er van Lück wegen Steuerhinterziehung anschwärzt, gelingt es Stolze, die Firmenleitung zu übernehmen. Seine Frau treibt er in die Alkohol- und Tablettensucht, bis sie im Vollrausch tödlich verunglückt. Mit der Hilfe seiner neuen Geliebten Sybille Curtius (Gudrun Landgrebe) steigt er in den Chemiekonzern von Harald Deterding (Arthur Brauss) ein, den er schließlich ebenfalls aus dessen eigenem Unternehmen vertreibt.
Nach der Wiedervereinigung dringt er mit dem Chemiekonzern in den Osten vor, um die Subventionen der Bundesregierung einzustreichen. Wanda Weissenfeld (Martina Gedeck) ist in dieser Zeit eine wichtige Verbündete, die schließlich ihren Lohn fordert und Stolze heiraten will, weshalb er sie als Stasi-Spitzel enttarnt. Stattdessen heiratet er Sybille, deren Ehemann Harald (Roland Schäfer) er vorher in den gesellschaftlichen Ruin getrieben hat. Während einer seiner Betriebe im Osten wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen in die Luft fliegt, erhält Stolze für sein Engagement in den neuen Bundesländern das Bundesverdienstkreuz.
Anspruchsvolle Detailzeichnung einer fiktiven, aber vorstellbaren Karriere mit einem glänzenden Götz George in der Rolle des skrupellosen Machtschweins.
Das Sonntagskonzert
1969–2005 (ZDF). 45-Minuten-Show am Sonntagmittag, in der mehrere musikalische Gäste aus dem klassischen oder volkstümlichen Bereich ihr Können zum Besten geben.
Gäste der ersten Sendung waren Anneliese Rothenberger, Hermann Prey und René Kollo, in der Folgewoche kamen Blaskapellen. Die Bandbreite war groß, jedoch nach Sendungen unterteilt. Die Ausgaben mit volkstümlicher Musik gastierten in verschiedenen Städten, meist in Deutschland, gelegentlich im benachbarten Ausland (zeitweise hießen sie Das Sonntagskonzert auf Tournee), und untermalten die musikalischen Auftritte mit Landschaftsaufnahmen aus der Gegend. Die Reihe Ihr Musikwunsch war zeitweise Bestandteil des Sonntagskonzerts.
Anfangs präsentierten Ruth Kappelsberger und Fred Rauch die Sendung, zu den späteren Moderatoren gehörten u. a. Lou van Burg, Elmar Gunsch und Elke Kast, Dieter Thomas Heck, Hans Rosenthal, Rainer Holbe, Monika Meynert und Elfi von Kalckreuth, Trudeliese Schmidt und Christian Boesch, Ilona Christen, Ramona Leiß, Christine Maier, Babette Einstmann, Wolfgang Binder, Uta Bresan, Reiner Kirsten, Björn Casapietra und eine Sängerin namens Inka, bei der es sich um die spätere RTL-Moderatorin Inka Bause handelte.
2005 wurde die Reihe aus Kostengründen eingestellt.
Das Strafgericht
2002–2008 (RTL). Einstündige Gerichtsshow mit dem echten Richter Ulrich Wetzel, der in fiktiven Verhandlungen über Kapitalverbrechen urteilt, die von Laiendarstellern an Laiendarstellern begangen wurden.
Lief werktags um 14.00 Uhr, ersetzte Bärbel Schäfer und ergänzte Die Jugendrichterin und das am gleichen Tag startende Familiengericht. Im Herbst 2007 sollte die Reihe eigentlich abgesetzt werden, blieb mangels Ersatz noch ein halbes Jahr um 16.00 Uhr im Programm.
Das Supertalent
Seit 2007 (RTL). Talentshow.
Menschen aller Altersklassen dürfen ihre Talente vor einem tausendköpfigen Publikum und einer dreiköpfigen Jury vorführen. Alles ist möglich: Singen, tanzen, turnen, jodeln, zaubern oder Witze erzählen. Dieter Bohlen, Ruth Moschner und der Zirkusdirektor André Sarrasani geben anschließend ihren Senf dazu und legen per Mehrheitsentscheid fest, wer in die nächste Runde kommt. Sie können die Auftritte auch schon vorzeitig abbrechen: Jeder hat einen Buzzer vor sich, der mit einem großen X das Ende der Geduld signalisiert. Dreimal X heißt Aus. Wie früher in der Gong-Show. Hinter der Bühne steht Moderator Marco Schreyl und ist nett zu den Teilnehmern. Im Finale entscheiden dann die Fernsehzuschauer per Telefonabstimmung darüber, wer das „Supertalent“ ist und 100.000 Euro gewinnt.
Die Show ist eine Adaption der Sendungen „America’s Got Talent“ und „Britain’s Got Talent“, hinter denen Simon Cowell als Produzent und Juror steht, der in gleicher Rolle auch die Vorlagen von Deutschland sucht den Superstar prägte.
Zwei 75-minütige Halbfinalsendungen und ein abendfüllendes Finale liefen samstags um 20.15 Uhr. Sieger dieser ersten kurzen Staffel wurde 19-jährige singende Schüler Ricardo Marinello aus Düsseldorf.
In der zweiten Staffel saßen neben Dieter Bohlen nun Sylvie van der Vaart und Bruce Darnell in der Jury, Marco Schreyl wurde von Daniel Hartwich unterstützt und der Auswahlprozess zog sich über insgesamt sieben Sendungen hin. Es gewann der 44-jährige Mundharmonika-Spieler Michael Hirte aus Karzow, der vor sechs Millionen Fernsehzuschauern spielte statt wie bisher vor Passanten in der Fußgängerzone.

Foto: RTL
Das Traumschiff
Seit 1981 (ZDF). Dt. Urlaubsserie.
Das Team eines Luxusschiffs, zunächst der MS Vistafjord, dann der MS Astor und ab 1986 der MS Berlin, versüßt seinen Passagieren die Kreuzfahrten zu den schönsten Urlaubszielen der Welt, während sich an Bord Familien- und Liebesgeschichten abspielen. Zunächst hat Kapitän Braske (Günter König) das Kommando, in der zweiten Staffel übernimmt Heinz Hansen (Heinz Weiss) und bleibt für 15 Jahre der Kapitän. Sein Team besteht aus Chefsteward Victor (Sascha Hehn) und Chefhostess Beatrice (Heide Keller), beide auch schon unter Braske an Bord, sowie dem Schiffsarzt Dr. Horst Schröder (Horst Naumann). Victor ist nach der zweiten Staffel nicht mehr dabei. Mit Hansens Nachfolger, dem neuen Kapitän Paulsen (Siegfried Rauch), kommt im Dezember 1999 auch ein neues Schiff: Die MS Deutschland ist noch luxuriöser. Beatrice und Dr. Schröder sind weiter mit an Bord.
Die Geschichten der Urlauber standen im Mittelpunkt jeder Folge. Meist drei oder vier dieser Geschichten wurden pro Folge erzählt und miteinander verwoben. Die Urlauber wurden von bekannten deutschen Fernsehstars gespielt, meistens von Klaus Wildbolz und Gila von Weitershausen. Beide spielten jeweils fünfmal mit, jedes Mal in anderen Rollen. Produzent Wolfgang Rademann legte Wert auf Hochglanz, steuerte mit dem Schiff nur ferne, exotische Ziele an (nie Malle), drehte an Originalschauplätzen in der Karibik, in Thailand, Südafrika, Ägypten, Tahiti, Singapur, Sydney, Hongkong, auf Hawaii oder Bali und wollte dem ZDF-Zuschauer in den Gastrollen Gesichter zeigen, die er kannte. Diese A-Liste endete nun einmal irgendwo, und so musste mancher eben mehrfach ran. Die Mitglieder der Familie Wussow waren immerhin so freundlich, sich abzuwechseln.
Die ersten zwölf Folgen waren jeweils eine Stunde lang, sie liefen in zwei Staffeln mit je sechs Folgen sonntags um 20.00 Uhr und erreichten im Durchschnitt mehr als 21 Millionen Zuschauer. Die eigentliche Serie ging dann mit Folge 12 und einer Rekordquote von 25,15 Millionen am 1. Januar 1984 zu Ende; das ZDF und Rademann setzten sie wegen dieses sensationellen Erfolgs aber nach einer knapp dreijährigen Pause fort. Alle weiteren Folgen hatten nun Spielfilmlänge, und das Schiff steuerte in jeder Folge ein neues Ziel an. Nach zunächst vier neuen Folgen im Winter 1986/87 gab es in den 90er-Jahren jedes Jahr meist zwei neue Folgen, in der Regel eine an Weihnachten und eine an Neujahr. Dass es nach 1990 überhaupt Fortsetzungen gab ‑ eigentlich war das Traumschiff offiziell „versenkt“ worden – lag an den hohen Einschaltquoten von Wiederholungen im Sommer. Neue Folgen erreichten noch immer rund zehn Millionen Zuschauer, in Zeiten großer Konkurrenz durch eine Vielzahl an Sendern fantastische Quoten. Ein Großteil des Erfolgs dürfte auch den atemberaubenden Bildern der Traumziele zuzuschreiben sein. Im Januar 2005 feierte Das Traumschiff die 50. Folge.
Das Traumschiff war eine Adaption der US-Serie Love Boat, das jedoch eine Comedy war. Mehrere Folgen sind auf DVD erhältlich.
Das unglaubliche Quiz der Tiere
Seit 2007 (ARD). Großes Abendquiz mit Frank Elstner.
Drei prominente Kandidaten stellen sich den Quizfragen, in denen sich alles um Tiere dreht. Auf diese Weise lernen die Zuschauer nebenbei kuriose Fakten, z.B. dass die grünen Meerkatzen auf der Karibikinsel St. Kitts gern Cocktails trinken, dass Löwen als Babys gepunktet sind, und dass es 200 Dollar Strafe kostet, wenn ein Autofahrer im US-Ort Olney ein weißes Eichhörnchen überfährt. Das erspielte Geld kommt einem guten Zweck der ARD-Fernsehlotterie zugute.
Produzent der 90-Minuten-Show ist Günther Jauch, der sich in die Premiere selbst als Kandidat einlud und die ARD damit werben ließ, dass Günther Jauch zum ersten Mal als Kandidat in einer Quizshow auftrete. Die Rechnung ging auf: Sieben Millionen Zuschauer machten die Show zu einem großen Erfolg, die daraufhin den Auftrag für Fortsetzungen erhielt. Sie läuft seitdem etwa alle sechs bis acht Wochen donnerstags um 20.15 Uhr.