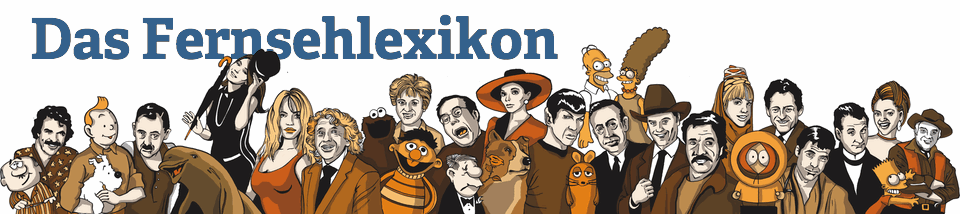Abenteuer am Roten Meer
1969–1978 (ZDF). 26-tlg. frz. Abenteuerserie von Jean O’Neill, Edmond Levy und Pierre Lary nach dem Buch von Henry de Monfreid, Regie: Claude Guillemot und Pierre Lary („Les secrets de la mer rouge“; 1968).
Der Abenteuerschriftsteller Henry de Monfreid (Pierre Massimi) bereist Anfang des 20. Jh. die Meere, wird als Raufbold, Schmuggler und Waffenschieber vom Persischen Golf bis Äthiopien gejagt. Im Alter von 31 Jahren bricht er nach Djibouti auf und macht das Rote Meer zu seinem Reich.
Die erste Staffel mit 25-Minuten-Folgen lief dienstags am Vorabend, eine weitere acht Jahre später montags nachmittags. Es war die erste Produktion dieser Art, die komplett im Iran gedreht wurde. Die Serie basierte auf dem Tatsachenbericht des echten Henry de Monfreid (1879–1974).