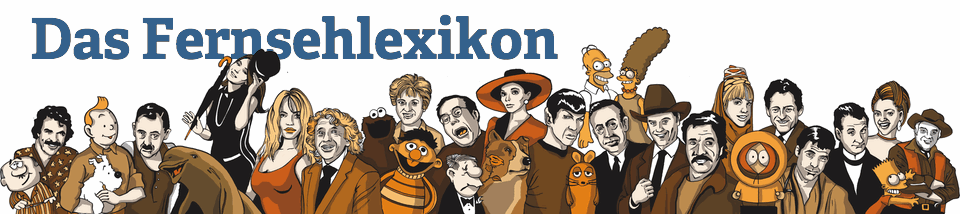Die Waltons
1975–1981 (ZDF); 1985 (Sat.1); 1994–1995 (ProSieben); 2004 (Kabel 1). 221 tlg. US-Familienserie von Earl Hamner, Jr. („The Waltons“; 1972–1981).
Die Familie Walton lebt zur Zeit der Depression in den 30er-Jahren in Walton’s Mountain in den Blue Ridge Mountains im US-Bundesstaat Virginia. Der autoritäre John Walton (Ralph Waite) und seine gottesfürchtige Frau Olivia (Michael Learned) sind die Eltern von sieben Kindern. Es sind dies der älteste Sohn John-Boy (Richard Thomas; ab der siebten Staffel: Robert Wightman), ein herzensguter Kerl, der gern Schriftsteller werden würde und die Erlebnisse der Familie niederschreibt; die älteste Tochter Mary-Ellen (Judy Norton; ab der vierten Staffel hieß sie Judy Norton-Taylor); der sensible Jim-Bob (David W. Harper); Ben (Eric Scott), der oft in krumme Geschäfte verwickelt wird; die hübsche Erin (Mary Elizabeth McDonough); der musikalische Jason (Jon Walmsley); und Nesthäkchen Elizabeth (Kami Cotler).
Die eigentlichen Familienoberhäupter sind die grantigen Großeltern Grandpa Sam (Will Greer) und Grandma Esther (Ellen Corby). Während die Familienmitglieder ihren Alltag bewältigen, lieben sich alle unentwegt und sehr. Das geringe Einkommen der Waltons stammt aus dem Sägewerk, das John und Sam gemeinsam führen.
Andere Bewohner des Orts sind Ike Godsey (Joe Conley), der Besitzer des örtlichen Gemischtwarenladens, seine Frau Corabeth (Ronnie Claire Edwards) und die von ihnen adoptierte Aimée (Rachel Longaker); die Baldwin-Schwestern Mamie (Helen Kleeb) und Emily (Mary Jackson), zwei alte Jungfern, die zu Hause nach dem Rezept ihres Vaters Whisky schwarzbrennen, aber keine Ahnung haben, was das Zeug eigentlich ist und es für „Medizin“ halten; Reverend Matthew Fordwick (John Ritter) und die Lehrerin Rosemary Hunter (Mariclare Costello), die irgendwann heiraten; sowie Sheriff Ep Bridges (John Crawford).
Im Lauf der Jahre gibt John-Boy seine eigene Lokalzeitung heraus, veröffentlicht schließlich einen Roman und zieht nach New York. Mary-Ellen heiratet Dr. Curtis Willard (Tom Bower), bringt Sohn John Curtis (Michael und Marshall Reed) zur Welt und wird Krankenschwester. Curtis kommt später im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Jason wird Pianist in einem Lokal, Ben hilft John-Boy bei dessen Zeitung und der Familie im Sägewerk und heiratet Cindy Brunson (Leslie Winston). Erin wird Sekretärin. Im Krieg sind alle vier Söhne beim Militär. Grandpa stirbt, Grandma wird sehr krank, und Olivia bekommt Tuberkulose, weshalb sie die Familie verlassen und im Sanatorium bleiben muss. Ihre Cousine Rose Burton (Peggy Rea) zieht mit ihren Enkeln Serena (Martha Nix) und Jeffrey (Keith Mitchell) in den Walton-Haushalt.
Grandpa Sam hatte im amerikanischen Original den Namen Zeb. Die Botschaft der Waltons war unmissverständlich: Die Zeiten können hart sein, aber wenn Familien zusammenhalten und die Frauen und Kinder das tun, was die Männer und Väter ihnen sagen, und wenn alle sich nur genug lieb haben, kommt man schon durch.
Die sentimentalen Erlebnisse wurden aus der Sicht des schreibenden John-Boy geschildert (im Original sprach sie Earl Hamner, Jr., auf dessen Leben die Geschichten beruhten). Während des Abspanns jeder Folge hörte man einen abschließenden moralischen Kommentar von ihm, jede Serienfolge endete anschließend damit, dass im Haus das Licht ausging und sich die Familienmitglieder gegenseitig eine gute Nacht wünschten. Konkret z. B. in Folge 69: „Gute Nacht, Jason.“ – „Gute Nacht, Jason. Gute Nacht, John-Boy.“ – „Gute Nacht, Mary Ellen. Gute Nacht, Ben.“ – „Gute Nacht, Jim Bob. Gute Nacht, Ben.“ – „Gute Nacht, Erin.“ – „Gute Nacht, Ben. Gute Nacht, Mary Ellen.“ – „Gute Nacht, Ma. Gute Nacht, Daddy.“ – „Gute Nacht, allesamt.“
Jede Episode dauerte 50 Minuten. Die Waltons liefen anfangs sonntags um 18.15 Uhr, dann samstags, im 14-täglichen Wechsel mit Bonanza, und wurden eine der beliebtesten Familienserien im deutschen Fernsehen und trotz des Sendeplatzes – zeitgleich mit der ARD-Sportschau – ein Straßenfeger, mit dem eine ganze Generation aufwuchs, die sich noch heute gut daran erinnert. 117 einstündige Folgen zeigte das ZDF, Sat.1 später elf und Pro Sieben weitere 69. Die letzten 22 Folgen, die bis dahin noch nie im bundesweiten Free-TV zu sehen gewesen waren, zeigte Kabel 1 im Herbst 2004, fast 30 Jahre nach dem Serienstart. Anfang des Jahres hatte der Sender mit einer Komplettwiederholung begonnen, der ersten Free-TV-Ausstrahlung seit vielen Jahren, und dafür noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt: Die Original-Walton-Darsteller Michael Learned, Judy Norton, Mary Beth McDonough, Kami Cotler, Eric Scott, John Walmsley und David Harper traten zum Start in Stefan Raabs TV Total beim Muttersender Pro Sieben auf.
Nach dem Ende der Serie entstanden rasch noch drei Fernsehfilme, die 3sat 1991 zeigte. Zwei weitere Filme aus den Jahren 1993 und 1995 liefen 1996 auf Pro Sieben, ein letzter von 1997 war bisher nur im Pay-TV zu sehen.
Die Welt
Was bislang fehlte, war ein Nachschlagewerk, in dem auch noch die beiläufigste Produktion ihre Würdigung erfährt. Schlicht „Das Fernsehlexikon“ heißt das Buch, das diese Lücke schließt; nicht mal mit dem sonst doch stets unvermeidlichen Zusatz „groß“ versehen. „Schwer“ wäre ohnehin treffender, das Werk wiegt gut und gern zwei Kilo. Kein Wunder bei über 1500 Seiten und mehr als 7000 Einträgen; allein das Personenregister umfaßt 85 Seiten.
[ganzer Artikel]
Die WiB-Schaukel
2002–2004 (ZDF). Porträtsendung mit Wigald Boning. Boning trifft Prominente zu Hause, in ihrer Heimatstadt oder an anderen mehr oder weniger bedeutungsschwangeren Orten und plaudert mit ihnen über ihr Leben, das Universum und den ganzen Rest.
Die Sendung war ursprünglich für Sun TV, das Rahmenprogramm der Ballungsraumsender von Leo Kirch, entwickelt worden, überlebte aber zum Glück deren Pleite. Das ZDF rettete die Sendung, versteckte sie allerdings tief im Nachtprogramm. Dabei war die WiB-Schaukel (der Name ist eine Anspielung auf die V.I.P.-Schaukel von Margret Dünser) ein Juwel: eine seltene Mischung aus großer Albernheit und großer Klugheit. Fast alle Prominenten unterschätzten den kleinen Mann in den albernen Klamotten, gingen ihm auf den Leim und verrieten viel mehr von sich, als sie wollten und es sonst taten.
Bonings Trick war oft, sie als das zu behandeln, was sie gern wären: Susan Stahnke, die so gern Hollywood-Star geworden wäre, wurde von ihm tatsächlich wie ein Hollywood-Star hofiert. Hinzu kam eine liebevolle Nachbearbeitung und ein spielerischer Umgang mit der Filmsituation, wenn Boning schweigend neben dem Porträtierten saß und sagte, da werde man nachher kluge Sätze draufsprechen, was entsprechend geschah. Festes Element der Sendung war eine halbe Minute, die jeder Prominente bekam, um für einen Zweck seiner Wahl zu werben.
Die Folgen liefen freitags weit, oft sehr weit nach Mitternacht. Die letzte Sendung war ein Best-of. 2004 erhielt Boning den Grimme-Preis.
Die Wicherts von nebenan
1986–1991 (ZDF). 50-tlg. dt. Familienserie von Justus Pfaue, Regie: Rob Herzet, Wolfgang Luderer.
Die Mittelstandsfamilie Wichert aus der Herzogstraße 36 in Berlin führt ein Durchschnittsleben mit Durchschnittssorgen. Eberhard (Stephan Orlac) und Hannelore (Maria Sebaldt) sind seit 25 Jahren verheiratet, die Söhne Rüdiger (Jochen Schroeder) und Andy (Hendrik Martz) schon erwachsen. Eberhard arbeitet als Schreinermeister in der Möbel-Union, sein bester Mann ist Heinz (Andreas Mannkopff). Chef der Möbel-Union ist Bernhard Tenstaag (Gerhard Friedrich), der lieber Golf spielt, als im Büro zu sitzen. Frau Glaubrecht (Gudrun Genest) ist dessen gutmütige Sekretärin.
Hannelore, von Eberhard zärtlich „Schnuppe“ genannt, hat eine kleine Getränkehandlung im eigenen Keller, die von dem mürrischen Kuttlick (Manfred Lehmann) beliefert wird. In ihrer Freizeit singen Hannelore und Eberhard in einem Chor in der „Harmonie“, der Kneipe von Conny (Brigitte Mira).
Bei den Wicherts wohnt Eberhards Mutter Käthe (Edith Schollwer), eine aufgetakelte, schwülstig sprechende Frau, die einfach nicht in das bürgerliche Umfeld passen will und in alltäglichen Situationen andauernd feststellt, dass „der Herr Bundeskanzler“ sich damit bestimmt nicht herumschlagen müsse. Für sie ist es das Größte, als der ältere Sohn Rüdiger, der Maschinenbau lernt, Uschi von Strelenau (Anja Schüte) heiratet, wodurch der Graf (Friedrich Schütter) und die Gräfin von Strelenau (Gisela Pelzer) seine Schwiegereltern werden und Käthe sich nun endlich als Mitglied der besseren Gesellschaft fühlen kann. Eher zufällig wird sie dann auch noch Werbemodel für das neue Möbel-Union-Programm mit dem Namen „Käthes Küche“. Einerseits genießt sie es, sich selbst auf Litfaßsäulen zu sehen, andererseits wäre ihr „Käthes Salon“ natürlich lieber gewesen.
Uschi bringt in der ersten Staffel Tochter Katharina (Sophie Birkner) und in der zweiten Sohn Sebastian (Oliver Lausberg) zur Welt. Der jüngere Wichert-Sohn Andy, von dem die Familie so gerne hätte, dass er Chirurg wird, lernt stattdessen nach dem Abitur Koch bei Monsieur Pierre (Peter Matic). Hannelores Vater Walter Pinnow (Ekkehard Fritsch) wohnt nicht im Haus, schaut aber regelmäßig vorbei. Unfreiwillig wichtigste Person im Leben der Wicherts ist neben der eigenen Familie der neugierige, naive und verstörte Nachbar Meisel (Siegfried Grönig), der dauernd ums Haus herumschleicht, seine Nase in alles steckt und immer seinen Kater Tassilo auf dem Arm hat.
In der zweiten Staffel wird Eberhard befördert, aber zugleich nach Gütersloh versetzt, um die dortige Filiale der Möbel-Union zu übernehmen. Die Fahrerei ist zermürbend, und schließlich tauschen Eberhard und Tenstaag die Posten, Tenstaag geht also nach Gütersloh und wird außerdem Vorstandsvorsitzender. Hannelore übernimmt Connys Kneipe und macht Kuttlick zum Kellner. Käthe hat jetzt einen Freund. Er heißt Dr. Dr. Gürtler (Karl Schönböck), und sie legt größten Wert auf beide Doktortitel, was Eberhard abtut mit: „Mutter und ihr Doppeldoktor!“
Walter gründet zusammen mit seiner Freundin Gerda Kusnewski (Inge Wolffberg) die private Wach- und Schließgesellschaft „Augen auf“, in der auch Alwin Barthold (Horst Pinnow) anfängt, der bisherige Buchhalter der Möbel-Union. Rüdiger wird Technischer Direktor einer Brauerei. Zu Beginn der dritten Staffel kommt er bei einem Betriebsunfall ums Leben. Hannelore gibt daraufhin ihre Kneipe an Kuttlik ab.
Andys Freundin Gaby (Roswitha Schreiner) verlässt ihn, um in Paris zu studieren. Zur Freude der Familie entschließt er sich nun doch, Medizin zu studieren, um Arzt zu werden. Mit seiner neuen Freundin Elke (Juliane Rautenberg) bekommt er einen Sohn, den sie Thomas nennen. Dem schmierigen Bankdirektor Kneisel (Wolfgang Bathke) gelingt es in der vierten Staffel, Eberhard aus der Möbel-Union zu vertreiben. Dieser eröffnet daraufhin seine eigene „Schreinerei Wichert“ und nimmt seinen Kollegen Heinz gleich mit. Hannelore betreibt jetzt den Partyservice „Schneller Teller“ im Keller.
Fünf Jahre lang liefen die einstündigen Episoden erfolgreich im Vorabendprogramm um 17.50 Uhr. Die auffälligsten und beliebtesten Figuren waren keine Mitglieder der Wichert-Familie: Nachbar Meisel und Eberhards Kollege Heinz wurden vom Publikum besonders ins Herz geschlossen. Produzent war Otto Meissner. Die Musik zur Serie komponierte Christian Bruhn. Im 90 minütigen Pilotfilm sang Andy Borg das Titellied, danach wurde nur noch eine Instrumentalversion verwendet.
Die Serie ist auf DVD erhältlich.
Die wilde Rose
1990–1991 (RTL). 99-tlg. mex. Telenovela („Rosa Salvaje“; 1988).
Das naive Mädchen Rosa Salvaje (Verónica Castro) lebt bei seiner Großmutter. Beim Versuch, auf der Plantage des reichen Ricardo (Guillermo Capetillo) Äpfel zu stehlen, erwischt dieser sie. Beeindruckt von ihrer Schönheit, überführt er sie nicht der Polizei, sondern schenkt ihr das Diebesgut. Um seinen älteren Schwestern (Liliana Abud, Laura Zapata), mit denen er stets im Streit liegt, eins auszuwischen, heiratet er das erstbeste Mädchen, das ihm begegnet: Rosa. Ohne Erfolg versuchen Ricardos Schwestern, die plötzlich zu Reichtum gekommene „Wilde Rose“ zu vertreiben, die jedoch entwickelt sich von einer Göre zur würdevollen Frau. Ricardo verliebt sich schließlich in sie. Als Rosa jedoch erfährt, dass die Hochzeit nur aus Protest gegen die Schwestern vollzogen wurde, verlässt sie ihn.
„Rosa Salvaje“ basierte auf der kubanischen Radionovela „Raquel“, die brasilianische Version der Serie trug den Namen „Rosa Rebelde“. Im Produktionsland Mexiko ist die Serie ein Klassiker und der Prototyp der neueren Telenovela. Die Serie Marimar machte es sich einige Jahre später leicht und verwendete einfach die gleiche Handlung. Beide Serien liefen bei uns werktäglich am Vormittag.
Die wilden Siebziger!
2000–2005 (RTL); seit 2008 (Kabel 1). 200-tlg. US-Sitcom von Bonnie Turner, Terry Turner und Mark Brazill („That 70’s Show“; 1998–2006).
Während der Disco-Ära Ende der 70er‑Jahre erleben die Freunde Eric Forman (Topher Grace), Donna Pinciotti (Laura Prepon), Michael Kelso (Ashton Kutcher), Jackie Burkhardt (Mila Kunis), Steve Hyde (Danny Masterson) und Fes (Wilmer Valderrama) ihre High-School-Zeit. Eric lebt bei seinen Eltern Kitty (Debra Jo Rupp) und Red (Kurtwood Smith) und seiner Schwester Laurie (Lisa Robin Kelly). Im Keller der Formans verbringt die Clique oft ihre Freizeit.
Wiederkehrende Besonderheit ist die Kameraeinstellung, wenn die vier Jungs im Keller sitzen und über das Leben sinnieren: Die gleiche Kamera zeigt dann nacheinander jeden einzeln in einer frontalen Großaufnahme, immer den, der gerade spricht, und dreht danach, ohne dass ein Schnitt gesetzt wird, weiter zum Nächsten.
128 Folgen der bunten Schlaghosenshow liefen erst am Samstagnachmittag, seit Herbst 2003 schon vormittags bei RTL. Im November 2007 begann werktags vormittags bei Kabel 1 ein Wiederholungsdurchlauf, dem sich zumindest eine bisher unausgestrahlte Staffel anschloss. Die siebte und achte Staffel wurden bisher nicht in Deutschland gezeigt.
Die wirklich wichtigen Themen des Lebens
Finden Sie, Tony Blair hat in der Angelegenheit der britischen Gefangenen im Iran richtig gehandelt? Hätte Helmut Kohl den Friedensnobelpreis wirklich verdient? Leiden Sie schon unter der Gesundheitsreform? Wo würden Sie Ihre Eier verstecken, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?
Es gibt ja so viele Fragen, mit denen man ein Meinungsforschungsinstitut beauftragen könnte, sie der deutschen Bevölkerung in einer repräsentativen Umfrage zu stellen.
Das Faltblatt „TV Guide“ entschied sich für diese: Glauben Sie an einen Quotenanstieg bei Verliebt in Berlin, wenn Lisa Plenske vorübergehend zurückkehrt? Vielen Dank dafür. Die Antwort lautet übrigens: Ja. Toll.
Die wissen tatsächlich, was gut ist
Heute startete auf dem Alles-Sendeplatz des ARD-Vorabendprogramms die neue Kuppel-Doku-Soap Ich weiß, wer gut für dich ist.
„Ich wusste schon, dass Bruce auf dem Sendeplatz nicht gut für mich ist!“, schreibt s.maetje in den Kommentaren zum Lexikoneintrag, und es ist kaum in Worte zu fassen, welch enorme Verbesserung der Bruce-Nachfolger ist. Jede Woche soll ein Single mit der Hilfe von vier Freunden verkuppelt werden. Jeder der Freunde organisiert ein Date, jeden Tag wird eins gezeigt. Im Prinzip ist die Reihe so ähnlich aufgebaut wie Das perfekte Dinner, nur dass hier nicht das Essen mit Punkten bewertet wird, sondern der, der es isst.
In den ersten fünf Minuten war die neue Reihe ungefähr so unterhaltsam wie eine gedruckte Kontaktanzeige im Wochenblatt, es wimmelte von Floskeln, und „Hobbys haben“ galt schon als Eigenschaft. Kandidatin Ilka tat kund, sie wünsche sich einen Landwirt. Huch! Ausgerechnet einen Landwirt, na so was. Aber wo bekommt man heutzutage noch einen Bauern her, der eine Frau sucht?
Doch dann bekam die Sendung plötzlich Charme und Witz. Ilkas erste Freundin organisierte ihr ein Date mit einem Wirt. Sie hatte wohl erst zur zweiten Silbe eingeschaltet, was verständlich ist, denn die Sendung hatte ein paar Minuten früher als ausgedruckt begonnen. Es folgten die üblichen mit der Kamera dokumentierten Anbandelungsversuche und die üblichen dazwischen geschnittenen Statements, und irgendwie war dabei doch gar nichts wie üblich: Die Interviewgeber waren zum Zeitpunkt ihrer Aussagen auf exakt demselben Stand wie die Zuschauer und durften das eben Gesehene nach Herzenslust gehässig kommentieren. Und natürlich hatten sie an allem etwas auszusetzen, schließlich waren sie ja der Meinung, ihr Kandidat, der in den nächsten Tagen noch folgen wird, sei sowieso der bessere.
Schon vor dem Date durchsuchten die Freundin und Ilka mit dem Einverständnis des Wirts, aber in dessen Abwesenheit, seine Wohnung, und auch das war bereits eine Gelegenheit für leidenschaftliches Lästern.
Ich weiß, wer gut für dich ist ist schnell und liebevoll geschnitten, kurzweilig, lustig und charmant und wird von einem zurückhaltenden Off-Sprecher begleitet, der nichts erzählt, was man sowieso sieht. Wer rechnet denn mit so was?
Es wäre schön, wenn das Erste mit dieser gelungenen Reihe endlich seinen Vorabenderfolg gefunden hätte. Sonst gibt’s auf dem Gemischtwarensendeplatz nämlich schon bald wieder ein Quiz, eine Weltkriegsdokumentation, eine Telenovela, das Beste aus dem Frühlingsfest der Volksmusik, eine bulgarische Sitcom oder einen Pantomimenwettbewerb.
Die Wochenshow
1996–2002 (Sat.1). „Die witzigsten Nachrichten der Welt“. Comedyshow am Samstagabend gegen 22.00 Uhr mit Parodien, Sketchen und Running Gags.
Zur Urbesetzung gehörten Ingolf Lück, Anke Engelke, Marco Rima und Karen Friesecke. Friesecke stieg bereits Ende 1996 aus, für sie kam Bastian Pastewka.
Die Show begann als halbstündige Nachrichtenparodie mit Lück als Anchorman hinter einem Schreibtisch. Lück zeigte zu mehr oder weniger aktuellen Themen Filme, die durch neue Synchronisation oder Schnitte verfremdet und in einen witzigen Zusammenhang gebracht wurden (Rudis Tagesshow hatte das 15 Jahre vorher schon mit Erfolg gemacht). Mit der Zeit kamen immer mehr feste Rubriken mit wiederkehrenden Figuren und Sprüchen dazu, die teilweise zu geflügelten Worten wurden.
Feste Bestandteile waren u. a. „Rickys Pop-Sofa“, Anke Engelke parodierte die Ex-Tic-Tac-Toe-Sängerin Ricky in einer fiktiven Teenie-Show; „Sex TV“ mit Bastian Pastewka als asexuellem Moderator Brisko Schneider („Hallo liebe Liebenden …!“); die Talkshow-Parodie „Vier um zehn“; Marco Rima als senil sinnierender Opa Adolf Frei; Ingolf Lück als Frührentner und Vordenker Herbert Görgens, der immer irgendeinen Blödsinn erfand und Reporter Pastewka mit der Frage nervte: „Komm ich jetzt im Fernsehen?“; Pastewka als Flachpfeife Ottmar Zittlau im Trainingsanzug; und Anke Engelke als Moderatorin des Nachrichtenüberblicks, an dessen Ende sie „zurück zu Lück“ gab, was der mit „Danke, Anke!“ kommentierte. In den ersten Monaten wirkte als ständiger Gast Herbert Feuerstein in der Rolle des Stuntmans Spartacus mit, der immer auf die Nase fiel.
Die anfangs mäßigen Zuschauerzahlen steigerten sich rasch und erreichten ab Ende 1997 sechs Millionen. Die Wochenshow wurde zum Muss und Anke Engelke von den Medien zu „Deutschlands witzigster Frau“ hochgejubelt und mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Grimme-Preis 1999. Diesen Erfolg reizte Sat.1 aus bis zum Gehtnichtmehr, verdoppelte die Sendezeit und zeigte ab 1998 immer im Anschluss an die neuen Ausgaben Wiederholungen alter Folgen unter dem Titel Die Wochenshow – Classics (während der Sommerpause liefen gleich zwei Wiederholungen hintereinander), außerdem gelegentlich Zusammenschnitte als Die Wochenshow – Extra. Fast im Alleingang schaffte es Die Wochenshow, ihrem Sender Sat.1 zu einem Comedy-Image zu verhelfen. Zur Sendung erschienen Videos und CDs.
Im März 1999 stieg Marco Rima aus und wurde durch Markus Maria Profitlich ersetzt. Der allmähliche Abstieg begann 2000. Im Frühjahr gab sich das komplette Ensemble für die fünfteilige Dauerwerbesendung Die Neckermann Geburtstagsshow her. Im Juni 2000 ging auch Engelke und wurde nach der Sommerpause durch Annette Frier ersetzt. Pastewka und Profitlich verließen die Show im Juni 2001, für sie kamen nach der Sommerpause gleich vier Neue: Nadja Maleh, Michael Kessler, Bürger Lars Dietrich und Gerhard G. Gschwind. Dem Namen angemessen verschwand Gschwind nach nur vier Wochen wieder, auch Maleh war bald wieder weg.
Im Frühjahr 2002 fielen die Quoten auf unter zwei Millionen, und Sat.1 beschloss, die regelmäßige Ausstrahlung einzustellen. Es folgten bis Juni 2002 noch zwei Specials zur Fußballweltmeisterschaft, ein weiteres Jahr Classics-Wiederholungen am Samstagabend und im April 2004 ein weiteres neues Special zum Jubiläum „20 Jahre Sat.1″.
Die Wombels
1977–1983 (ZDF); 1998 (KI.KA). 99-tlg. brit. Puppentrickserie nach Geschichten von Elisabeth Beresford („The Wombles“; 1973–1998).
Die Wombels sind kleine, dickbäuchige, zottelige Wesen mit spitzen Schnauzen. Sie leben in Wimbledon in niedlichen Erdlöchern, die mit alten Zeitungen tapeziert sind, und sammeln den Müll, den die Menschen überall herumliegen lassen, um ihn auf originelle Art wiederzuverwerten. Familienoberhaupt ist Großonkel Bulgaria, zur Sippschaft gehören außerdem Orinoco, Wellington, Tomsk, Tobermory und Bango. Madame Cholet ist die französische Haushälterin. Erzähler ist Dieter Hallervorden (im englischen Original: Bernard Cribbins), der auch allen Wombels die Stimme leiht.
Die fünfminütigen Folgen liefen dienstags im Vorabendprogramm. Der Titelsong lautete: „Umwelt fängt an vor der eigenen Tür. / Wombles sind Wesen, die tun was dafür. / Leise und freundlich und sauber sind sie. /Jeder muss wombeln, denn sonst klappt das nie!“ Komponiert hat ihn Mike Batt. In Großbritannien schaffte es der „Wombling Song“ ebenso wie diverse Nachfolgelieder sogar in die Charts.
Zum 25-jährigen Jubiläum wurden 39 neue Folgen der Serie produziert, die in Deutschland der KI.KA zeigte. Jetzt verfügten die Wombles auch über Internet und Womfaxe und hatten einige neue Freunde: Miss Alderney, Shansi, Stepney und Obidos. Der Text der Titelmusik war dem Zeitgeist entsprechend weniger ökologisch engagiert und dafür eine platte Übersetzung des englischen Originals: „Oberirdisch, unterirdisch, wombeln wir los. / Wir Wombles sind auf jeder Wiese ganz groß. / Machen tolle Sachen, und jetzt haltet Euch fest, / mit allerhand Müll, den man hier hinterlässt.“