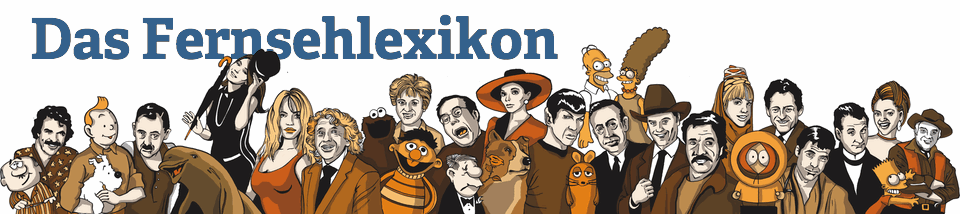Das große Los
1996–2000 (ZDF). Einstündige Spielshow mit Dieter Thomas Heck zugunsten der ZDF-Fernsehlotterie Aktion Sorgenkind.
In einem Quiz treten drei Kandidatenpaare, die sich jeweils für einen bestimmten sozialen Zweck engagieren, gegeneinander an und versuchen möglichst viel Geld für ihr Projekt zu erspielen. Jede Sendung befasst sich mit einem bestimmten Jahr, auf das sich Fragen, Sketche und ein Musikquiz beziehen: Drei Interpreten präsentieren einen Ausschnitt aus einem ihrer großen Hits. Die Kandidaten müssen erraten, welches Lied aus dem jeweiligen Spieljahr stammt. Daneben finden in der Show die monatlichen Auslosungen für die Fernsehlotterie statt.
Das große Los lief einmal im Monat live donnerstags um 20.15 Uhr. Es folgte als Aktion-Sorgenkind-Sendung auf die schrecklich gefloppten Shows Goldmillion und Wunder-Bar, setzte in jeder Hinsicht auf Altbewährtes und brachte es damit immerhin auf fast vier Jahre Lebensdauer. Sie wurde eingestellt, als die Aktion Sorgenkind in Aktion Mensch umbenannt wurde. Der Nachfolger war dann wieder kurzlebig. Er hieß Jede Sekunde zählt.
Das große Glück des ZDF
(Meine Frau) sagte zu mir, das größte Glück im Leben sei nicht, einen Parkinson-Patienten zu haben als Ehemann, sondern mich zu haben.
Michael J. Fox sagte diesen Satz in seiner Dankesrede bei der Verleihung der Goldenen Kamera. Zumindest wenn man dem Simultandolmetscher des ZDF glaubt. Aber warum sollte man dem jemals glauben? ZDF-Dolmetscher machten auch schon aus Madonnas Satz „Could you make my son a hat“ zu zwei strickendem Damen auf der Couch von Wetten, dass…? die Übersetzung „Können Sie mir einen Sonnenhut machen?“, und aus ihrer Bemerkung zu einem Kandidaten „You look like Eminem“ „Du siehst aus wie ein M&M“.
Diesmal hörte man zum Glück sehr deutlich, wie Michael J. Fox in Wirklichkeit nicht „luck“ sagte, sondern „challenge“. Und schon wird aus einer Entgleisung eine liebevolle Pointe.
(Meine Frau) sagte zu mir, die größte Herausforderung in ihrem Leben sei nicht, einen Parkinson-Patienten als Ehemann zu haben, sondern mich zu haben.
Das Halstuch
1962 (ARD). 6-tlg. dt. Krimi von Francis Durbridge, Regie: Hans Quest.
Kriminalinspektor Harry Yates (Heinz Drache) von Scotland Yard, sein Kollege Sergeant Jeffreys (Eckart Dux) und Police Officer Kent (Gerhard Becker) suchen einen Mörder, der mehrere Frauen mit einem Halstuch erwürgt hat. Das erste Opfer war das Model Fay Collins, die Schwester des gehbehinderten Musiklehrers Edward Collins (Hellmut Lange). Später stirbt auch Diana Winston (Eva Pflug). Hinterbliebene, Zeugen oder Verdächtige sind u. a. der Zeitschriftenverleger Clifton Morris (Albert Lieven), Mariann Hastings (Margot Trooger) und ihr Mann, der Gutsbesitzer Alistair Goddman (Erwin Lindner), Gerald Quincey (Christian Doermer), Vikar Nigel Matthews (Horst Tappert), der Maler John Hopedean (Dieter Borsche) und die Tänzerin Kim Marshall (Erika Beer).
Das Halstuch war eine Neuauflage des britischen Sechsteilers „The Scarf“ (1959). Der Krimi war in Deutschland ein phänomenaler Erfolg und einer der ersten wirklichen Straßenfeger. Das ganze Land fieberte mit und rätselte, wer wohl der Halstuch-Mörder sein könnte. Die Einschaltquote betrug im Schnitt noch nie und nie wieder da gewesene 89 %! Einen Skandal verursachte der Kabarettist Wolfgang Neuss, als er einen Tag vor der letzten Folge die Nation per Zeitungsanzeige wissen ließ: „Ratschlag für morgen: Nicht zu Hause bleiben, denn was soll’s: Der Halstuch-Mörder ist Dieter Borsche. Also: Mittwochabend ins Kino. Ein Kinofan.“ Bei späteren Durbridge-Krimis wurden deshalb gelegentlich mehrere Schlussszenen gedreht. Es gab auch die Überlegung, für die ja meist schon im Ausland gelaufenen Krimis einen neuen deutschen Schluss mit anderem Mörder zu schreiben.
Dass der Krimi wie bei Durbridge üblich eine nicht einmal halbwegs realistische Märchengeschichte aus dem fernen England war, schreckte Nachahmungstäter nicht ab: In der Woche nach der Ausstrahlung meldete die deutsche Polizei zwei vollendete Morde mit einem Halstuch und einen Versuch. Nicht nur deshalb löste Das Halstuch eine heftige Diskussion aus, ob das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen solch rein auf Sensation angelegte Unterhaltung zeigen sollte. Der nächste Durbridge in Deutschland, Tim Frazer, wurde weniger spektakulär inszeniert.
Die Folgen waren jeweils ca. 40 Minuten lang, später wurde der Schwarz-Weiß-Krimi auch als Drei- oder Zweiteiler wiederholt.
Das Holodeck von CNN
Natürlich ist es geschichtlich nicht ganz unbedeutend, dass in der vergangenen Nacht zum ersten Mal ein Schwarzer zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, aber das eigentlich historische Ereignis war zweifellos, dass CNN zum ersten Mal Korrespondenten in sein Wahlstudio beamen ließ. Gut, „beamen“ trifft es nicht ganz, und auch der Begriff „Hologramm“, den CNN benutzte, ist technisch gesehen nicht korrekt, denn das Abbild der Korrespondenten war im Studio nicht sichtbar, sondern entstand erst im Fernsehbild. Aber das sind Kleinigkeiten angesichts dieses revolutionären Einbruchs der Science-Fiction in unsere TV-Gegenwart:
Später wiederholte CNN den Trick mit dem Rapper will.i.am.
Die Technik ist, wie man an den unsauberen Umrissen sieht, noch nicht ausgereift, aber der Aufwand ist gigantisch. Die Korrespondenten stehen, umgeben von 35 Kameras, die sie von allen Seiten filmen, in einem Raum. Mehrere Computer errechnen aus den Bewegungen der Kameras im Studio den richtigen Blickwinkel der Aufnahmen vor Ort und überlagern die Bilder.
Das Ergebnis ist ebenso bizarr wie sinnlos. CNN-Moderator Wolf Blitzer erklärte der Korrespondentin Jessica Yellin (die sagte, sie fühle sich wie Prinzessin Leia in „Star Wars“), das sei angenehm, sich so in Ruhe unterhalten zu können — ohne die lärmenden Menschenmassen, die sonst hinter ihr stünden. Aber erstens sind lärmende Menschenmassen oder auch nur das Live-Bild eines irgendwie relevanten Gebäudes im Hintergrund in neunzig Prozent der Fälle genau der Grund, warum man überhaupt zu einem Korrespondenten vor Ort schaltet: um eine Illusion von Nähe zu einem Ereignis zu schaffen. Und zweitens hätte sich die Korrespondentin für ein ruhiges Gespräch auch einfach in ein Zimmer in der Nähe zurückziehen und vor eine ordinäre Kamera stellen können.
Aber dann hätte natürlich niemand gesagt: Boah, was die bei CNN können!
Das ideale Brautpaar
1959 (ARD). Hochzeitsshow mit dem beliebten Karnevalisten Jacques Königstein, der als Showmoderator durchfiel. Seine Spiele mit Brautpaaren sollten eigentlich eine Reihe werden, brachten es aber nach verheerenden Zuschauerreaktionen nur auf eine einzige Ausstrahlung. Michael Schanzes Flitterabend wurde später mit einem ähnlichen Konzept ein Erfolg.
Das Inselduell
2000 (Sat.1). Psycho-Reality-Doku-Soap-Spielshow.
Das Inselduell war quasi Big Brother unter Palmen. Nach dem großen Erfolg von Big Brother brach im deutschen Fernsehen ein Boom von Reality- und Psycho-Spielshows aus. Diese neue Show gab es gleich zweimal. Big Brother-Sender RTL 2 nannte sie Expedition Robinson und Sat.1 eben Das Inselduell. 13 grundverschiedene Kandidaten wurden auf der unbewohnten malaysischen Insel Simbang ausgesetzt und mussten wochenlang ohne Hilfsmittel aus der Zivilisation überleben. Sie hatten weder Essen noch alltägliche Gebrauchsgegenstände wie Zahnbürsten oder Seife zur Verfügung. Das Essen mussten sie sich irgendwie selbst beschaffen, außerdem Hütten bauen, um einen Schlafplatz zu haben, und dabei stets mit der Hitze von 40 Grad und 85 Prozent Luftfeuchtigkeit klarkommen und gegen Regen, Stechmücken und Flöhe kämpfen. Außerdem stellte die Redaktion Aufgaben für Wettkämpfe, für die es zwischendurch kleinere Preise zu gewinnen gab. Jede Woche stimmten die Gestrandeten offen darüber ab, wer am wenigsten in die Gruppe passte und die Insel verlassen solle – Werbeslogan: „Nur einer kommt durch!“ Unter den Letzten wählte schließlich das Publikum per Telefon den Sieger, der 250 000 Mark gewann. Ein bayerisches Kraftpaket namens Michael war der Glückliche. Kameras filmten die Kandidaten bei ihrem Überlebenskampf, jeden Montag um 20.15 Uhr lief ein einstündiger Zusammenschnitt. Holger Speckhahn moderierte die insgesamt neun Folgen.
RTL 2 drehte seine Version zur gleichen Zeit auf der Nachbarinsel Tengah, sendete sie aber – zeitgleich mit dem ORF und deshalb unflexibel – erst einige Monate später. Immerhin hatte der Sat.1‑Titel so doch noch seine Berechtigung: Ein „Inselduell“ ist schließlich nichts anderes als ein Kampf zwischen zwei Inseln.
Das ist Ihr Leben
1976–1979; 1994—1996 (ZDF). Sentimentale Überraschungs-Porträt-Show mit Carheinz Hollmann.
Das Leben von Prominenten ist ein offenes Buch. Dieses rot eingefasste Buch hält Hollmann in der Hand, um daraus in jeder Sendung einem unter einem Vorwand ins Studio gelockten Stargast vorzulesen, was dieser schon weiß, nämlich wie sein bisheriges Leben verlief. Er wird mit Bildern und Filmen aus seiner Vergangenheit konfrontiert und begegnet Freunden und Kollegen.
Viel Zeit zum Plausch blieb selten, es wollten ja innerhalb einer Stunde des Abendprogramms möglichst viele Stationen einer Biografie abgehakt werden. Wer bei Hollmann zu Gast war, konnte die berühmte Frage „Kennen Sie es, wenn plötzlich Ihr ganzes Leben vor Ihren Augen vorbeizieht?“ mit Ja beantworten. Der Unterschied der Show zu einem freundlichen Nachruf war im Wesentlichen, dass der Porträtierte noch lebte und sich alles in Ruhe anhören konnte (oder musste). Dietmar Schönherr war der erste Gast. Die Kritik hasste die Show, weil alles rosarot gefärbt und extrem berechenbar war: Am Ende traten immer alte Schulfreunde und Lehrer auf, man fiel sich in die Arme und heulte, und das Publikum schaltete ein und heulte mit.
Hollmann erhielt später den „Fernseh-Mythos-Preis“ für die erste Überraschungsshow des deutschen Fernsehens. Im November 1994 startete das ZDF eine Neuauflage mit Dieter Thomas Heck, jetzt staffelweise dienstags um 20.15 Uhr, 45 Minuten lang. Vorbild war das US Format „This Is Your Life“.
Das iTeam — Die Jungs an der Maus
2008 (Sat.1). Dt. Sitcom.
Weil ihr ebenso launischer wie planloser Chef Oswald Bornholm (Sky du Mont) Teamgeist über alles stellt und Teamunfähigen sofort kündigt, zwingen sich Tom Zacher (Sebastian Münster), Gabriel Baumann (Stefan Puntigam) und Sandy Grünwald (Britta Horn) zur Zusammenarbeit. Tom und Gabriel sind zwei weltfremde Computerfreaks aus der IT-Abteilung der Bornholm AG, denen Sandy als Abteilungsleiterin vor die Nase gesetzt wurde, obwohl sie von Computern keinen Schimmer hat. Hinter einer mysteriösen roten Tür im Keller des Unternehmens lebt außerdem der Gruftie Kai (Niels Bormann).
Uninspirierte Adaption der erfolgreichen britischen Serie „The IT Crowd“. Zwei halbstündige Folgen liefen freitags um 21.45 Uhr vor so wenigen Zuschauern, dass danach schon Schluss war.
Das Jugendgericht
2001–2007 (RTL). Tägliche einstündige Gerichtsshow um 16.00 Uhr, die sich mit Straftaten jugendlicher Täter zwischen 14 und 21 Jahren beschäftigt. Die Fälle sind frei erfunden und die Täter nur Laiendarsteller.
Erste Richterin war Dr. Ruth Herz, die, bevor sie über die schauspielerischen Leistungen von sonst unbescholtenen Jugendlichen im Fernsehen urteilte, eine der profiliertesten Jugendrichterinnen in Deutschland war. Sie förderte in den 80er-Jahren maßgeblich das Konzept des Täter-Opfer-Ausgleichs und wurde für ein Projekt auf diesem Gebiet 1998 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 2005 folgte sie einem Ruf der Universität Oxford. Ihre Nachfolgerin bei RTL wurde Kirsten Erl.
Das Jugendgericht war die erste Antwort von RTL auf den Erfolg von Richterin Barbara Salesch bei Sat.1. Produzentin beider Sendungen war Gisela Marx. Eine Reaktion auf erfolgreiche Sat.1-Formate war auch der Umbau der Sendung im August 2006: Die eigentliche Verhandlung nahm von nun an nur noch einen kleinen Teil der Zeit in Anspruch, aus dem Rest der Sendung wurde ein pseudodokumentarischer Krimi wie Lenßen & Partner, in dessen Mittelpunkt bei RTL der Staatsanwalt Christopher Posch stand. Insofern war die Kompletteinstellung des Jugendgerichts im Februar 2007 nur konsequent, denn ihr Sendeplatzersatz hieß Staatsanwalt Posch ermittelt.
Das kann ja heiter werden
1982-1983 (ZDF). „Verrückte Sachen mit Peer Augustinski“. 21-tlg. dt. Comedyserie von Kalle Freynik, Regie: Sigi Rothemund und Frank Strecker.
Peer (Peer Augustinski) ist Besitzer einer Pension für Musiker, das heißt, genau genommen ist er Chef, Page, Küchenjunge und notfalls auch Hotelarzt in einer Person. Er hat nämlich kein Personal und verkleidet sich je nach Bedarf. Das führt zu dem nahe liegenden Chaos, in das jedes Mal andere Musiker und Schauspieler verwickelt werden, die in dem Hotel absteigen, um sich auf ihre Auftritte vorzubereiten. Unter anderem schauen Paul Kuhn, Elisabeth Volkmann, Truck Stop, Ted Herold, Gottlieb Wendehals und Frank Zander vorbei.
Die halbstündigen Folgen liefen dienstags am Vorabend.