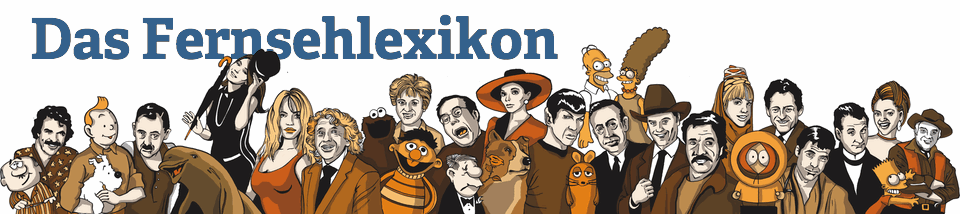Deutsche in Amerika
2006 (arte). 4-tlg. Geschichtsdokureihe von Fritz Baumann, die anhand von Einzelschicksalen den Weg deutscher Auswanderer nach Amerika seit dem 18. Jahrhundert nachzeichnet.
Lief zuerst im Rahmen zweier Themenabende bei arte und ab 25. Juli 2007 mittwochs am späten Abend in der ARD.
Deutschland lacht
1992 (ZDF). Halbstündige Witzeshow mit Karoline Reinhardt, die mit einem Käfer durch Deutschland fuhr und Menschen „Witze am laufenden Band“ erzählen ließ. Witzkandidaten im Studio konnten eine tolle Radkappe gewinnen. Wirklich.
Einer der Autoren der Sendung war Jürgen Fliege, der später als Talk-Pfarrer mit der Sendung Fliege bekannt wurde. Reinhardt war schon zuvor als Assistentin in Wim Thoelkes Der große Preis aufgefallen. Ihre eigene Show hatte zwar hervorragende Marktanteile, wurde aber sowohl von Kritikern als auch ZDF-intern so sehr als geschmackliche Entgleisung gesehen, dass der Sender sie nach einer Folge an einem Donnerstag am Vorabend und zwei weiteren freitags um 22.15 Uhr absetzte und vier weitere, schon gedrehte im Giftschrank verschwinden ließ. Stattdessen wiederholte er Folgen von Ein verrücktes Paar.
Deutschland sucht den Superstar
Seit 2002 (RTL). Talentshow und die Fernsehsensation des Jahres 2003.
Im Rahmen von 15 Abendshows wird ein Nachwuchssänger gesucht, der zum Star aufgebaut werden soll. Unter allen Bewerbern (60 000 allein für die erste Staffel) trifft eine Jury (Popstar und Produzent Dieter Bohlen; der damalige Chef der Plattenfirma BMG, Thomas M. Stein; der Radiomoderator Thomas Bug und die englische Musikjournalistin Shona Fraser) eine Vorauswahl; in mehreren Castingrunden wird schließlich auf 30 Kandidaten reduziert, die sich in der Show bewähren und ab jetzt der Telefonabstimmung durch die Fernsehzuschauer stellen müssen. Die letzten zehn treten in großen Live-Abendshows gegeneinander an. Der jeweils Letztplatzierte scheidet aus, die anderen treten in der nächsten Sendung mit neuen Liedern an. Die Platzierungsreihenfolge der im Wettbewerb verbleibenden Kandidaten wird nie bekannt gegeben. Die Jury sitzt bei jedem Auftritt und kommentiert ihn, maßgeblich ist jedoch die Telefonabstimmung. Im großen Finale schließlich wählen die Zuschauer zwischen den beiden verbliebenen Kandidaten ihren Superstar. Der Gesamtsieger erhält einen Plattenvertrag und muss ein Lied singen, das Dieter Bohlen geschrieben hat.
Die Idee war zwar auch in Deutschland nicht neu – die RTL 2-Reihe Popstars hatte bereits zwei erfolgreiche Gruppen hervorgebracht, andere Reihen waren gefloppt -, doch das Vorbild für diese spezielle Veranstaltung war die britische Show „Pop Idol“, die als „American Idol“ auch schon erfolgreich in die USA exportiert worden war. Auch in Deutschland wurde sie eine Quotensensation. RTL zeigte in der ersten Staffel die Zusammenschnitte der Castings samstags um 19.10 Uhr mit guten, aber nicht überragenden Quoten. Zu sehen waren darin überwiegend Teenager, die mangelndes Talent durch Selbstüberschätzung zu kompensieren versuchten und von Dieter Bohlen rüde abgefertigt wurden. Erst die Entscheidungsshows mit den Live-Auftritten, samstags um 21.15 Uhr, machten die Show zu einem Großereignis, und das trotz der Moderatoren Michelle Hunziker und Carsten Spengemann, der ebenfalls mangelndes Talent durch Selbstüberschätzung wettmachte.
Weil immer nur ein Kandidat ausschied und die Zuschauer zu den übrigen eine Beziehung aufbauen konnten, stieg die Einschaltquote von Woche zu Woche an und gipfelte schließlich bei fast 13 Millionen Zuschauern in der vorletzten Show am 15. Februar 2003, eine Zahl, die das Finale drei Wochen später am 8. März 2003 knapp verfehlte. Die eigentlich auf eine Stunde angesetzten Live-Shows hielten ihre Sendezeit nie ein und überzogen in der Spitze um fast eine Stunde. RTL sah es gern, denn auf diese Weise konnten die hohen Quoten über einen längeren Zeitraum gehalten werden. Eine Stunde nach Ende der Show folgten noch einmal 20 Minuten (es war in der Regel gegen Mitternacht), in denen das Abstimmungsergebnis verkündet wurde. Davon profitierten die Comedyshows Krüger sieht alles und Olm!, die von den Superstars umklammert wurden und ebenfalls Rekordquoten erzielten.
Gesamtsieger der ersten Staffel wurde Alexander Klaws, dessen Song „Take Me Tonight“ umgehend Platz eins der Charts erreichte. Zuvor hatte bereits der Song „We Have A Dream“, den alle zehn Finalteilnehmer gemeinsam aufgenommen hatten, wochenlang den ersten Platz belegt. Eigentlicher Star der ersten Staffel war jedoch der Drittplatzierte Daniel Küblböck, ein 17-jähriger Bayer, dessen Stimme ungefähr so viel Wohlklang hatte wie eine ICE-Bremse, der durch sein kindlich-quirliges und verstörend-androgynes Auftreten jedoch sofort zum Publikumsliebling wurde und die Menschen polarisierte. „Bild“ erfand für ihn die Bezeichnung „schräger Daniel“, eine riesige Fangemeinde versammelte sich hinter ihm, doch schließlich entschied in der vorletzten Sendung die Mehrheit gegen ihn und wählte Alexander und Juliette Schoppmann ins Finale. Daniels Single „You Drive Me Crazy“, die nur zwei Wochen nach der Alexanders erschien, löste Alexander auf Platz eins der Charts ab. Auch sein Hit stammte aus Bohlens Feder. Juliette veröffentlichte ebenfalls eine Single, wollte aber musikalisch nichts mehr mit Bohlen zu tun haben. Ihr „Calling You“ erschien einige Monate später und erreichte knapp die Top 10. Auch andere Finalrundenteilnehmer schafften den Sprung in die Charts. Die Fünftplatzierte Gracia Baur gewann zwei Jahre später haushoch den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest, bei dem sie dann jedoch ebenso deutlich den letzten Platz belegte.
Im Sog des Erfolgs überschwemmten noch im Sommer 2003 etliche weitere Talentshows den Bildschirm, die erfolgreichste unter den Kopien war Star Search in Sat.1, die ähnlichsten Fame Academy bei RTL 2 und Die Deutsche Stimme im ZDF.
Im September 2003 startete RTL die zweite Staffel und zeigte die Casting-Shows jetzt mittwochs um 20.15 Uhr, ebenfalls die Shows, in denen die Fernsehzuschauer unter den Top 50 ihre Finalkandidaten auswählten. Die zugehörige Ergebnissendung unterbrach am gleichen Abend stern tv. Die Mottoshows liefen wieder am Samstag und blieben weit hinter den Quotenerwartungen zurück, erreichten jetzt kaum noch fünf Millionen Zuschauer und wurden zum Teil von Ausstrahlungen alter Spielfilme auf Sat.1 geschlagen. Auch der Gesprächswert war weg, Charterfolge der Teilnehmer waren nicht mit früheren vergleichbar, die Gewinnerin hieß Elli Erl. Ihr „This Is My Life“ kam immerhin auf Platz 3.
Dennoch startete RTL Ende 2005 die dritte Staffel, die überraschend den Erfolg der zweiten deutlich übertraf. Die Sendeplätze wurden beibehalten, das Personal dagegen fast komplett ausgetauscht. Dieter Bohlen, der einzige wirkliche Superstar in der gesamten Sendung, durfte als Einziger bleiben und saß nun in der auf drei Personen verkleinerten Jury neben der Marketingmanagerin Sylvia Kollek und dem früheren Plattenboss und unverkennbaren Kölner Heinz Henn. Tooske Ragas und Marco Schreyl wurden als neue Moderatoren engagiert, was eigentlich auch egal war. Nur der „Bild“-Zeitung schien es nicht egal zu sein, die eine wochenlange rassistische Hetzjagd auf die Niederländerin Ragas veranstaltete. Der Gesamtsieger Tobias Regner schaffte mit „I Still Burn“ wieder einen Nr.1-Hit, eine Rockballade, mit der Dieter Bohlen diesmal nichts zu tun hatte, ebenso der Zweitplatzierte Mike Leon Grosch mit „Don’t Let It Get You Down“. Sieben Millionen Menschen sahen das Finale, eine Zahl, die in der vierten Staffel schon in der Castingphase übertroffen wurde, dafür später nicht mehr. Neu in der vierten Staffel ab Januar 2007 war Anja Lukaseder, die in der Jury den Platz von Sylvia Kollek übernahm. Moderatorin Tooske Ragas war nur zeitweise dabei, weil sie im Lauf der Staffel Mutter wurde. Es gewann Mark Medlock, dessen wiederum von Dieter Bohlen produzierter Titel „Now Or Never“ Platz 1 erreichte. Bohlen hatte Medlock schon während der Showphase so sehr gefördert wie keinen Kandidaten zuvor. In der Folgezeit traten die beiden als Duo auf und hatten noch im gleichen Jahr mit „You Can Get It“, einer inhaltlichen Variation des alten Modern-Talking-Hits „You Can Win If You Want“, einen weiteren Nr.1-Hit und mit „Unbelievable“ einen weiteren Top-10-Erfolg.
In der fünften Staffel ab Januar 2008 übernahm Andreas „Bär“ Läsker den Jury-Platz von Heinz Henn, und Tooske Ragas war nun dauerhaft schwanger und gar nicht mehr dabei. Gewinner wurde Thomas Godoj, dessen erster Hit den Titel „Love Is You“ erhielt.
Ein Begleitmagazin zur Sendung lief erst auf den RTL-Schwestersendern Vox und Super RTL, schließlich auch bei RTL selbst.
Deutschland sucht den Superstar, von Fans liebevoll abgekürzt als DSDS, erhielt den Deutschen Fernsehpreis 2003 (beste Unterhaltungssendung).
Deutschland sucht den Superstar – Das Magazin
2002–2004 (Vox); seit 2005 (Super RTL); ab 24.02.2007 (RTL). Einstündiges Begleitmagazin zur RTL-Show Deutschland sucht den Superstar. Lief montags um 20.15 Uhr und wurde während der ersten beiden Staffeln von Peer Kusmagk und Tamara Gräfin von Nayhauß moderiert. Als sei Kusmagks Name nicht schon kompliziert genug, nannte er sich ab der zweiten Staffel Peer Karlinder Kusmagk. Zur dritten Staffel behielt das Magazin zwar seinen Sendeplatz, wechselte aber den Sender und die Moderatoren. Auf Super RTL waren dies Nina Moghaddam und David Wilms. Nina Moghaddam moderiert auch die RTL-Version, die ab Ende Februar 2007 zusätzlich auf den Bildschirm kommt.
Deutschlands Talente
2003 (ARD). 45-minütige Talentshow mit Eva Herman.
In jeder Sendung traten fünf Nachwuchskünstler auf: Sänger, Imitatoren, Tänzer, Artisten, Comedians. Das Publikum in der Halle wählte den Sieger. Er bekam 5000 €.
Die Show, in der auch die Gewinner der Deutschen Fernsehlotterie gezogen wurden, war eine der großen Hoffnungen der ARD, ihre Unterhaltung zu retten. Es blieb bei einem einzigen Versuch auf dem eigentlichen Sendeplatz am Montag um 20.15 Uhr. Nach demütigenden 2,3 Millionen Zuschauern wurden die restlichen drei Ausgaben montagnachmittags um 15.15 Uhr versendet.
Dexter
Ab 29. September 2008 (RTL 2). US-Krimiserie nach den Büchern „Des Todes dunkler Bruder“ und „Dunkler Dämon“ von Jeff Lindsay („Dexter“; seit 2006).

Foto: RTL 2
Dexter Morgan (Michael C. Hall) ist besessen von Blut. Aus seiner Leidenschaft hat er einen Beruf gemacht: Für die Polizei in Miami untersucht er an Tatorten die Blutspritzer und schafft es, daraus Informationen über den Tatablauf und den Täter zu gewinnen. Aber es ist auch eine Art Hobby: Dexter bringt Verbrecher um, die ihrer vermeintlich gerechten Strafe sonst entkommen würden, und sammelt ihre Blutproben. Seit einem traumatischen Erlebnis in seiner Kindheit empfindet Dexter keine Gefühle und hat das Bedürfnis zu töten. Sein verstorbener Adoptivvater Harry Morgan (James Remar), ein Polizist, der Dexters Soziopathie erkannte, brachte ihm früh bei, Emotionen vorzutäuschen und sich beliebt zu machen und gab ihm eine seinem Defekt angepasste Ethik mit auf den Weg: Dexter soll nur Leute umbringen, die es auch verdient haben.
Bei der Polizei in Miami arbeiten auch Dexters Adoptivschwester Debra Morgan (Jennifer Carpenter), sein Kumpel Angel Batista (David Zayas) und Sergeant James Doakes (Erik King), der Dexter nicht ausstehen kann und sein düsteres Geheimnis ahnt. Leiterin der Mordkommission ist Lieutenant Maria LaGuerta (Lauren Vélez), die Dexter fördert und Debra bei der Arbeit behindert. Mit Rita Bennett (Julie Benz) führt Dexter so etwas ähnliches wie eine Beziehung: Sie ist nach dem Missbrauch durch ihren Ex-Ehemann traumatisiert, was praktisch für ihn ist, weil er dadurch als ihr Beschützer auftreten kann, ohne echte Nähe ertragen zu müssen. Ein Problem, aber auch eine willkommene Herausforderung wird für Dexter der (sich über die gesamte erste Staffel ziehende) Fall eines Kühllaster-Killers, der seine Opfer sauber zerlegt und völlig blutleer hinterlässt und mit ihm ein Spiel zu spielen scheint.
Brutale, kontroverse und erfolgreiche Serie, die auf der Idee beruht, dass das beste Mittel gegen Serienkiller ein Serienkiller ist. Dexter ist zwar nicht immer sympathisch, vor allem, wenn er mit großer Liebe zum Detail die möglichst schmerzhafte Tötung seiner Opfer zelebriert, aber doch der Held der Serie, die ihm auch den schwarzen Humor verdankt. Über die Moral der Geschichte denkt der Zuschauer am besten ebensowenig nach wie über die Logik der Fälle.
RTL 2 zeigt die gut einstündigen Folgen montags gegen 23 Uhr.
Dharma & Greg
1999–2003 (ProSieben). 119-tlg. US-Sitcom von Chuck Lorre („Dharma & Greg“; 1997–2002).
Die flippige Hippietochter und Yoga-Trainerin Dharma Finkelstein (Jenna Elfman) und der konservative Anwalt Greg Montgomery (Thomas Gibson) heiraten noch am Tag ihres Kennenlernens. Greg macht im Laufe der nächsten Jahre noch oft ein herrlich dummes Gesicht, wenn Dharma mit größter Selbstverständlichkeit einfach mal ein paar Tage im Wald wohnen will oder schlimmer: in aller Öffentlichkeit im Ausstellungsschlafzimmer eines Möbelhauses – Dinge eben, die ihm nicht fremder sein könnten. Noch heftiger prallen für ihre beiden Elternpaare Welten aufeinander. Larry (Alan Rachins) und Abby (Mimi Kennedy) sind Dharmas weltoffene Eltern, Edward (Mitchell Ryan) und Kitty (Susan Sullivan) die reichen und vornehmen Etepetete-Eltern Gregs. Dharma hat einen Hund namens Stinky, und Stinky hat einen Hund namens Nunzio. Streng genommen haben Dharma und Greg also zwei Hunde, Stinky hat Nunzio aber von Dharma geschenkt bekommen, und damit ist Nunzio eben Stinkys Hund. Pete (Joel Murray) ist Gregs Kollege, Jane (Shae D’lyn) Dharmas beste Freundin. Die beiden werden später ein Paar.
Lief zunächst am späten Montagabend, in Wiederholungen und ab der zweiten Staffel auch als Erstausstrahlung am Samstagnachmittag.
Diamantendetektiv Dick Donald
1971 (ZDF). 13-tlg. dt. Actionserie von Heinz Bothe-Pelzer, Regie: Jürgen Goslar, Erich Neureuther.
Dick Donald (Götz George) ist als Detektiv in Südafrika Diamantenschmugglern und -dieben auf der Spur. Er arbeitet im Auftrag des internationalen Diamantensyndikats IDSO. Daisy Johnson (Loni von Friedl) ist seine Assistentin.
Rasante Krimiserie mit viel Geballer und Verfolgungsjagden, die an Originalschauplätzen in Südafrika gedreht wurde. Ihr Ende blieb offen: Ein schwer verwundeter Dick Donald bricht am Schluss von Folge 13 zusammen, und die Serie ist zu Ende. Eine Fortsetzung gab es nicht. Götz George hatte später als Schimanski im Tatort wesentlich größeren Erfolg. George und von Friedl waren damals im wirklichen Leben ein Paar.
Die halbstündigen Folgen liefen mittwochs am Vorabend.
Dick und Doof
1970–1973 (ZDF). 98-tlg. US-Slapstickreihe.
Weit mehr als 100 Kurz- und Spielfilme hatten die amerikanischen Komiker Stan Laurel und Oliver Hardy produziert, die nur in Deutschland als Dick (Hardy) und Doof (Laurel) bekannt wurden. Einige davon hatten es auch ins Fernsehen geschafft, vor allem in Reihen wie Es darf gelacht werden und Spaß muss sein. Nachdem ZDF-Redakteur Gert Mechoff, Synchron-Autor und -Regisseur Heinz Caloué und Sprecher Hanns Dieter Hüsch gemeinsam bereits den dänischen Stummfilmkomikern Pat & Patachon zu neuem Glanz im fernsehfreundlichen 25-Minuten-Format verholfen hatten, nahmen sie sich die gleiche Methode auch für die Filme von Laurel und Hardy vor.
Die konkrete Vorgehensweise unterschied sich je nach vorhandenem Material. Manche bereits synchronisierte Tonfilme musste Caloué nur kürzen oder in mehrere Fortsetzungsgeschichten aufteilen. Stummfilme wurden meist mit Hanns Dieter Hüsch als ironischem Kommentator und Sprecher aller Rollen synchronisiert — mit allen Freiheiten, die dem Witz dienten: Manche Stummfilmgags erzielten eine bessere Wirkung, wenn sie unkommentiert stehen blieben, andere Stellen wurden zusätzlich mit bissigem Kommentar aufgewürzt. Manchmal wurden die Filme aber auch mit mehreren Sprechern vertont — mit Walter Bluhm als Laurel und Bruno W. Pantel als Hardy. Wenn frühere Synchronisationen verwendet wurden, waren als Hardys Stimmen noch Arno Paulsen und Gerd Duwner zu hören (Verhandlungen mit Duwner waren an dessen Honorarforderungen gescheitert).
Nicht selten waren die fertigen 25 Minuten eine Collage aus Szenen ganz verschiedener Filme. Einmal gelang es Caloué sogar, aus einem in der Steinzeit spielenden Film („Flying Elephants“) und einem, der im 20. Jh. angesiedelt ist („Putting Pants On Philip“), einen einzigen Film zusammenzuschnipseln – aber vielleicht sollte man besser sagen: Er tat es; ob es ihm „gelang“, darüber gingen die Meinungen auseinander. Caloué verteidigte sich, dass das meiste, was er wegschnitt, ohnehin nur „Füllmaterial“ gewesen sei: Langatmige Autofahrten und Spaziergänge flogen raus, und es blieb das Wesentliche – fliegende Torten, stolpernde Menschen, Finger im Auge, zu Bruch gehende Einrichtung, Staub. Und mittendrin: Stan und Ollie in Anzug und Melone. „Schau, was du wieder angerichtet hast, Stan“, wurde Ollies oft gehörter Satz, wenn Stans Tölpelhaftigkeit wieder größere Sachschäden verursacht hatte. Und dann gab es immer noch einen Schutzmann, der den beiden hinterherlief, und eine hysterische alte Frau.
Geprägt wurden die entstehenden neuen Fassungen nicht zuletzt durch die Musik. In den meisten Fällen zeichneten dafür Fred Strittmatter als Komponist, Quirin Amper jr. als Arrangeur und Komponist und Jiří Kanzelsberger als Musikregisseur verantwortlich. Das Puzzle- und Synchronisations-Prinzip von Caloué und Mechoff reflektierte die Formulierung im Vorspann: „… frisch aufpoliert von …“. Dieses Prinzip prägte über die nächsten 15 Jahre weite Teile des ZDF-Vorabendprogramms. Es wurde für weitere Reihen mit Schwarz-Weiß-Slapstick-Szenen benutzt, darunter Väter der Klamotte, Spaß mit Charlie und Männer ohne Nerven, aber auch für Zeichentrickklassiker wie Mein Name ist Hase, Schweinchen Dick und Die schnellste Maus von Mexiko.
Dick und Doof fanden ihren festen Sendeplatz freitags am Vorabend und bis zu 16 Millionen Zuschauer. Weitere Varianten ihrer Filme liefen unter den Titeln Zwei Herren dick und doof, Lachen Sie mit Stan und Ollie und Meisterszenen mit Stan Laurel und Oliver Hardy.
Didel-di-hei, didel-di-hau, didel-di-hei-di-hau
Es folgt eine längere Besprechung der neuen Sendung TV-Helden. Für alle, denen das zu viel Text ist, bieten wir vorab eine Kurzfassung an: Lustig. Ansehen! Bitte sehr.

Screenshot: RTL
Das waren noch Zeiten, als Hape Kerkeling ernste Pressekonferenzen mit dummen Fragen sprengte oder sich verkleidete und ernste Kulturinteressierte foppte, indem er ihnen „Hurz“ vorsang und anschließend die Intention des Dargebotenen interpretieren ließ.
Vielleicht hat sich ähnliches seither niemand mehr getraut, weil sich niemand mit dem großen Kerkeling messen lassen wollte. Vielleicht hat es auch jemand versucht, scheiterte aber so kläglich, dass man es schon wieder verdrängt hat.
Die TV-Helden, wie RTL seine neue Samstagspätabendcomedy nennt, trauen sich wieder, und sie halten dem Vergleich mit Kerkeling stand.
Einer ihrer Scherze ging vor zwei Wochen schon durch die Medien, die nicht wussten, was sie damit anfangen sollten: Die Gründung des 1. Türkischen Karnevalsvereins Deutschlands in Köln wurde bekanntgegeben. Die Gründungsmitglieder forderten einen Türken im Dreigestirn und den Verzicht auf Freizügigkeit und Alkohol. Sie gaben eine gut besuchte Pressekonferenz, und obwohl dabei offenbar wurde, dass keiner der drei auch nur ein Wort Türkisch sprach, glaubten viele Zeitungen auch am nächsten Tag noch, die Sache sei echt. Für den betriebenen Aufwand ist das, was daraus heute Abend im Fernsehen zu sehen ist, überraschend kurz. Überhaupt wird kein Gag länger ausgewalzt als er lustig ist, und lustig sind fast alle: Caroline Korneli, die denselben Interviewpartnern für zwei vorgeblich unterschiedliche Magazine gegensätzliche Aussagen entlockt, Pierre M. Krause, der versucht, im Gespräch mit dem saarländischen SPD-Spitzenkandidaten Heiko Maas 25 Wortspiele mit dem Namen „Maas“ unterzubringen, und Jan Böhmermann, der den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein fragt, ob er Angst vor Bushido habe und anfängt gezielt kindisch zu kichern, wenn Beckstein „Konvertiten“ sagt und die zweite Worthälfte wie „Titten“ klingt. Wie das gespielt und geschnitten ist, erinnert das an die „Korrespondenten“ in der Daily Show with Jon Stewart, und ebenfalls in diesem Stil, aber mit Kerkeling-Methoden, wird auch noch Medienkritik laut, wenn Krause und Böhmermann durch ständiges Anrufen (und Durchkommen!) den Abzocksender Astro-TV entlarven. Allein die Kosten für diese Anrufe dürften einen erheblichen Anteil am Budget der Sendung ausgemacht haben.
Leider mussten vielleicht deshalb wohl noch ein paar Minuten Sendezeit kostengünstiger gefüllt werden, weshalb die Helden nun zu Beginn der Sendung und immer wieder zwischendurch aufgereiht hinter Mikrofonen stehen und dem Studiopublikum, das ebenfalls stehen muss, Witze erzählen, die bemüht wirken. Das Publikum gibt auffallend unauthentische Reaktionen von sich, und in dem Geklatsche gehen dann die hinführenden Anmoderationen unter, die für die Filmzuspielungen eigentlich ganz nützlich wären. Die Studiomoderationen waren in SketchUp schon überflüssig und der schwächste Teil in Ladykracher, und jetzt ziehen sie die TV-Helden unnötig in die Länge, die davon abgesehen witzig, mutig, originell und schnell sind. Und das Allerbeste: Weder werden Sketche gespielt, noch eine Kamera versteckt.
RTL hat die Qualität der Sendung anscheinend erkannt und versteckt sie nicht am toten Comedyfreitag, sondern gibt ihr den durchaus prominenten Sendeplatz direkt nach dem Dschungelfinale. Nächste Woche gibt es noch eine zweite Folge. Eine Fortsetzung darüber hinaus wäre wünschenswert, wenn die Qualität hält.
TV-Helden, heute um 23.30 Uhr bei RTL.
Nächste Woche um 23.15 Uhr.
Disclosure: Ich bin mit Pierre M. Krause befreundet, habe mit ihm für eine andere Sendung bereits Sketche geschrieben und gespielt und musste mir dafür dämliche Kostüme anziehen. Ich finde seine Arbeit nicht deshalb lustig, weil ich das getan habe, sondern habe das getan, weil ich ihn lustig finde. Da ich auch die Teile ohne ihn bei TV-Helden als äußerst gelungen erachte, halte ich mich für unvoreingenommen. Pierre M. Krause hat mir kein Geld für diese Besprechung gegeben, und auch für ein Bier hat er eigentlich nie Zeit.