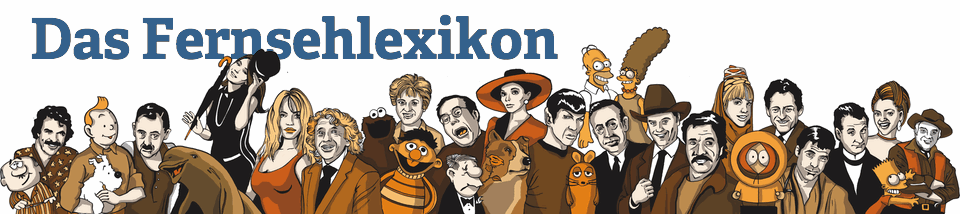Einer gegen 100
2002; 2008 (RTL). Quizshow.
Ein Kandidat spielt gegen 100 Studiogäste. Alle müssen die gleichen Multiple-Choice-Fragen beantworten, der Gewinn des Kandidaten errechnet sich aus der Anzahl der Studiogäste, die die Frage nicht beantworten konnten. Diese scheiden dann aus. Der Kandidat auf dem Stuhl in der Mitte hat gewonnen, wenn nur noch er übrig ist. Er hat drei Joker und kann gegen 25 bzw. danach 50 und 75 Prozent seines bisher erspielten Gewinns die richtige Antwort kaufen. Scheidet er mit einer falschen Antwort aus, wird aus den noch übrigen Studiogästen ein neuer Kandidat ermittelt, der dann wieder bei 100 Gegnern beginnt.
Die erste Version der Quizsendung war ein einstündige Abendshow mit Linda de Mol und eigentlich ein später Nachzügler der durch Wer wird Millionär? ausgelösten Quizwelle. Die 100 Gegner bildeten zugleich das Studiopublikum. Obwohl auch Einer gegen 100 an Stimmigkeit und Genialität (und Erfolg!) natürlich nicht annähernd an das Original heranreichte, war es einer der gelungeneren Ableger. Weil Linda de Mol so naiv, unwissend und anteilnehmend war und gar nicht erst in die Versuchung kam, Jauch zu kopieren. Und weil der Kampf Einer gegen 100 ein originelles Element war, auch wenn die Regeln zu vielen Ungerechtigkeiten führten, wie der, dass einige Gewinner nach endlosen Kämpfen und überragenden Leistungen mit lächerlichen Beträgen nach Hause gehen mussten.
Lief zunächst samstags zur Primetime, direkt nach Wer wird Millionär?, und erreichte in diesem Sog sehr gute Quoten und bis zu sieben Millionen Zuschauer. Im Sommer 2002, während der Sommerpause von Wer wird Millionär?, übernahm Einer gegen 100 dessen Sendeplätze am Montag und Freitag um 20.15 Uhr und verschwand danach. Sechs Jahre später startete RTL im Mai 2008 eine Neuauflage mit Wolfram Kons, jetzt als halbstündige Show jeden Werktag um 17.00 Uhr. Die 100 Gegner sitzen nun in beleuchteten Kabinen und haben auch einen Ansporn, denn scheidet der Kandidat vorzeitig aus, teilen sich die verbliebenen Gegner seinen bis dahin erspielten Gewinn. Unter ihnen sitzen auch jetzt auch Prominente und ehemalige Millionengewinner aus Wer wird Millionär?. Die Joker für den Kandidaten sind andere als früher: Er kann sich jetzt einen Gegner herazuspicken und ihn als Experten befragen, er kann von einem Zufallsgenerator zwei Gegner mit unterschiedlichen Antworten herauspicken lassen und sie nach ihrer Begründung für ihre Antworten fragen, und er kann für seine bevorzugte Antwortmöglichkeit erfragen, wie viele Gegner auch so geantwortet haben. Ein Studiopublikum gibt es jetzt zusätzlich zu den Gegnern.
Die Neuauflage währte nur bis zum Herbst.
Einer und zwei halbe Männer
Ashton Kutcher wird offenbar der neue Hauptdarsteller in Two And A Half Men und damit Nachfolger von Charlie Sheen. Mehrere Quellen berichten das. Kutcher würde natürlich nicht die Charlie-Harper-Rolle weiterspielen, sondern eine neue bekommen. Eingeführt werde er auf eine Weise, die die Fans sehr zufriedenstellen werde, ist Produzent Chuck Lorre schon mal zufrieden.
Eine offiziell formulierte Bestätigung gibt es noch nicht, aber Ashton Kutcher fragte vor ein paar Stunden auf seinem Twitter-Account: „Was ist die Wurzel aus 6,25?“
Einer wird gewinnen
1964-1987 (ARD). „Das große internationale Quiz“ mit Hans-Joachim Kulenkampff.
Acht Kandidaten (je vier Männer und Frauen) aus acht Ländern spielen in wechselnder Zusammenstellung im Ausscheidungsverfahren gegeneinander. In der ersten Runde treten jeweils zwei Kandidaten gleichen Geschlechts gegeneinander an und müssen Fragen zur Allgemeinbildung beantworten. Beide bekommen die gleichen Fragen gestellt, weshalb einer immer in eine schalldichte Kabine muss. Die vier Sieger ziehen in die Zwischenrunde ein. Bei einem Gleichstand gibt es anfangs zunächst Stichfragen, dann wird gegebenenfalls gewürfelt, in den 80er‑Jahren wird sofort gewürfelt. Für die Zwischenrunde werden zwei gemischt-geschlechtliche Zweierteams ausgelost, die nun gemeinsam weitere Wissensfragen beantworten und Geschicklichkeitsübungen bewältigen müssen. In einem Spiel teilen sie sich auf. Einer der beiden bekommt drei Fragen gestellt. Weiß er die Antwort nicht, kann sein Mitspieler durch die Geschicklichkeitsaufgabe den Punkt doch noch holen. In einem anderen, reinen Fragespiel dürfen sie sich beraten und müssen sich dann auf eine gemeinsame Antwort festlegen. Die beiden Mitglieder der Siegermannschaft spielen nun im Finale gegeneinander. Einer nimmt auf einem Sessel Platz, der auf einem Podest steht, und beantwortet drei Fragen, während der andere wieder in der schalldichten Kabine sitzt, weil ihm anschließend dieselben Fragen gestellt werden. Bei einem Gleichstand entscheiden bis zu zwei Stichfragen, danach wird notfalls der Gewinn geteilt. Zwischen den Spielrunden gibt es drei Showauftritte.
Der Titel der Show wurde „EWG“ abgekürzt, was nicht zufällig auch die Abkürzung für die gerade zusammenwachsende „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“ war. Das Quiz war eine der erfolgreichsten, beliebtesten und langlebigsten Sendungen, die es im deutschen Fernsehen gab. Sie lief als große Abendshow ca. sechsmal im Jahr samstags live um 20.15 Uhr, war eigentlich 105 Minuten lang, Kulenkampff („Kuli“) überzog aber ständig. Bis auf die Geschicklichkeitsspiele in der Zwischenrunde bestanden alle Runden aus Fragen zur Allgemeinbildung. Die Fragen wurden durch aufwendige Bauten, Kulissen, musikalische Darbietungen, Live-Spielszenen mit prominenten Schauspielern oder Einspielfilme illustriert, waren letztendlich aber doch immer nur Wissensfragen, die auch ohne diese Gimmicks hätten gestellt werden können. Das hätte die Show auf etwa eine Dreiviertelstunde gekürzt, sie aber eintöniger gemacht: Durch Bauten und Kostüme unterschied sie sich vom klassischen Abfragequiz. In den Einspielfilmen spielte Kulenkampff selbst mit und parodierte in pompösen Kostümen Figuren der Historie oder des klassischen Theaters. Es folgten Fragen aus den Bereichen Geschichte oder Theater und Literatur. Wer ausschied, erhielt als Trostpreis Goldmünzen, deren Zahl höher wurde, je länger der Kandidat im Spiel war. Der Hauptgewinn für den Sieger lag zu Beginn bei 2000 DM, Ende der 60er‑Jahre schon bei 4000 und zum Schluss bei 8000 DM.
Obwohl die Kandidaten nicht – wie z. B. in Peter Frankenfelds Sendungen – spontan aus dem Publikum ausgewählt wurden, sondern vorher feststanden, kannte Kuli sie nicht, bevor sie auf die Bühne kamen. Oft wirkte es, als habe auch sonst niemand, der an der Show beteiligt war, eine Ahnung gehabt. So fragte Kulenkampff fast 24 Jahre lang bei den Namen seiner ausländischen Mitspieler immer wieder nach, und 1969 gewann eine Medizinerin, nachdem ihr, aber auch allen anderen Kandidaten, im Laufe des Abends etliche Fragen aus dem Bereich Medizin gestellt worden waren. „Menschenskinder, das konnte ja keiner ahnen!“. Ach, nicht? Die Kandidaten kamen immer aus acht verschiedenen Ländern, deren Zusammenstellung variierte. Wer zu Kuli kam, sprach zwar in der Regel hervorragend deutsch, hatte gegenüber den Muttersprachlern aber einen leichten Nachteil. Bei den meisten Fragen gab es eine zeitliche Begrenzung von zehn Sekunden. Wer dann noch im Geiste die Frage übersetzen musste, hatte nicht mehr viel Zeit zum Nachdenken. So gewannen selten die Teilnehmer aus Großbritannien, Italien, Spanien, Jugoslawien, Ungarn, der Tschechoslowakei, Finnland, Schweden, Holland, Dänemark oder den USA, dafür meistens die Deutschen, Österreicher oder Schweizer.
EWG war eine Eurovisionssendung und wurde aus wechselnden Hallen übertragen.
Was EWG einzigartig machte, waren vor allem Kulis endlose Monologe. Eingangs machte er einige Witze zum aktuellen Tagesgeschehen, während der Show wich er vom eigentlichen Thema ab und nahm einzelne Bestandteile einer Antwort oder eines Gesprächs zum Anlass, darüber zu referieren. Fiel ihm eine Anekdote zum Beruf oder zur Herkunft eines Kandidaten ein, erzählte er sie. Fiel ihm noch eine ein, erzählte er sie auch. Er überschüttete seine Kandidatinnen (und vor allem seine Assistentinnen) mit Komplimenten, war immer der große Charmeur mit einem Hang zum Herrenwitz. Zwischendurch begrüßte er die gerade dazugekommenen Zuschauer der soeben im anderen Programm zu Ende gegangenen Fußball-Übertragung, telefonierte mit den „hohen Herren“, die die Einhaltung der Spielregeln überwachten und bei Unklarheiten anriefen, und ging auf Beschwerden ein, die während der Live-Sendung telefonisch beim Sender eingegangen waren. Nach einem Verriss in einer Tageszeitung griff er den Hauptkritikpunkt auf und hieß die Zuschauer beim nächsten Mal zu einem „langweiligen Abend“ willkommen, denn nach einer stressigen Woche habe jeder das Recht auf ein wenig Langeweile.
Je länger die Sendung lief, desto mehr rückte Kulenkampff selbst in den Mittelpunkt. Oft überzog er seine Sendezeit um eine halbe Stunde oder länger – und zelebrierte es.
Am Ende jeder Show trat Martin Jente (der Produzent der Sendung) als Butler „Herr Martin“ auf, der Kuli den Mantel brachte und einige spitze Bemerkungen zur Show und ihrem Quizmaster anbrachte („Immer wenn ich Ihre Sendung sehe, denke ich: Seine Stärke muss doch auf einem anderen Gebiet liegen“). Im Januar 1969 überreichte Jente Kuli noch vor dem Mantel den erstmals verliehenen Fernseh-Bambi (was Kulenkampff eine schöne Gelegenheit für eine kleine Rede gab). Kuli verschliss im Lauf der Jahrzehnte einige junge Assistentinnen, die bekanntesten waren in den 60er‑Jahren Uschi Siebert und in den 80ern Gabi Kimpfel. Das Orchester des Hessischen Rundfunks lieferte die musikalische Untermalung, anfangs unter der Leitung von Willy Berking, der mit Kulenkampff schon in Die glücklichen Vier aufgetreten war, später geleitet von Heinz Schönberger, der ebenfalls schon eine andere Kuli-Show mitgemacht hatte: Acht nach acht.
Insgesamt dreimal nahm Kuli seinen Hut als Moderator von EWG, zweimal ließ er sich überreden, die Sendung neu aufzulegen. Nach seinem Abschied im August 1966 dauerte es nur eineinhalb Jahre, bis er zurückkehrte. Nach weiteren eineinhalb Jahren gab er die Sendung im August 1969 zum zweiten Mal auf. Diesmal dauerte es fast zehn Jahre, bis es ein erneutes Comeback gab. In den ersten vier Jahren waren zwei neue Quizsendungen mit Kulenkampff gefloppt. Kulenkampff hatte damals geschworen, nie mehr ein Quiz zu moderieren. Sechs Jahre später, im September 1979, kehrte er mit EWG auf den Bildschirm zurück. Sein Abschied im Jahr 1987 nach 82 Ausgaben war endgültig. Man erkannte es daran, dass er sich von Paul Anka eine auf ihn umgemünzte Version von „My Way“ singen ließ (Anka war der Autor des Songs, er hatte ihn für Frank Sinatra geschrieben). Außerdem hielt er zum Abschluss eine Best-of-EWG-Schallplatte hoch („Ich möchte das auch einmal tun!“), von deren Erlös ein paar Mark an die Stiftung zur Rettung Schiffbrüchiger gingen („Ich segel doch so gern“). Auf diese Weise habe er schon einen Teil abbezahlt, falls er mal aus dem Meer gefischt werden müsse.
Der Versuch einer Neuauflage mit dem neuen Moderator Jörg Kachelmann im Jahr 1998 misslang grandios.
Einer wird gewinnen
1998 (ARD). Katastrophale Neuauflage der früheren Erfolgssendung mit Hans-Joachim Kulenkampff, jetzt mit dem Meteorologen Jörg Kachelmann.
Wieder spielten acht Kandidaten aus acht Ländern zur besten Sendezeit in einer großen Show gegeneinander, mit ein paar Prominenten mehr als damals. Kachelmann hatte die Show von Anfang an nicht im Griff, redete schon in der Sendung vom „Generalanschiss“, den er hinterher erwartete. Kandidaten kapierten seine langatmigen Spielerklärungen nicht, der Regieassistent wies ihn während der Sendung darauf hin. Kachelmann war nervös, suchte nach der richtigen Kamera und musste brüllen, um sich gegen den lautstark randalierenden Mob von Fußballfans aus 21 Ländern durchzusetzen, der zur Illustration eines Spiels eingesetzt wurde.
Eine Pilotsendung, die Kachelmann um 50 Minuten überzogen hatte, wurde als „unsendbar“ eingestuft (und dann doch aus finanzrechtlichen Gründen nachts im Hessen-Fernsehen versendet). Nicht einmal seine Einschätzung in der Premiere traf zu: „Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Sprung für mich.“ Nach drei Sendungen am Samstagabend hatte einer verloren.
Einfach Millionär
2004–2005 (ARD). 90-minütige Spielshow der ARD-Fernsehlotterie mit Frank Elstner.
Prominente Kandidaten treten in uralten Fernsehspielen gegeneinander an. Mangels neuer Ideen bereitet die Show „die spannendsten und lustigsten Spiele aus 50 Jahren“ Fernseh-Restmüll auf, und in Einzelfällen ist das auch noch fast so lustig wie damals. 64 Losinhaber im Publikum müssen den Spielausgang tippen. Es kommen nicht diejenigen in die nächste Runde, die den richtigen Sieger vorhersagen, sondern die, die in der Hälfte des Publikums sitzen, in der die meisten Losinhaber richtig getippt haben. Am Ende jeder Show gewinnt ein Kandidat eine Million €.
Die unterhaltsamsten Momente hatte die Show, wenn Ausschnitte aus den Originalsendungen von damals gezeigt wurden. Das kam nicht unbedingt Elstner zugute, denn man merkt im Nachhinein, wie glücklich man sich schätzen kann, dass es damals z. B. Hans Rosenthal war, der Dalli Dalli moderierte. Reporterin für Außenaktionen war Monica Lierhaus.
Die Show lief ein paarmal im Jahr donnerstags zur Primetime. Anfang 2005 wurde das Konzept dahingehend geändert, dass nicht mehr namentlich genannte Shows nachgespielt wurden, sondern die Prominenten nun kuriose Wettbewerbe (ohne Vorbild) gegeneinander bestreiten mussten. Das erinnerte stark an Elstners frühere Shows Wetten, dass…? und Aber hallo!, wurde aber nicht beim Namen genannt. Im April 2005 wurde die Show plötzlich unter dem Vorwand abgesetzt, sie sei ein „schwieriges Format, weil sie stark mit rechtlichen Vorgaben belastet“ sei. Das Format werde jedoch weiterentwickelt.
Einmal im Leben
1972 (ARD). „Geschichte eines Eigenheims“. 3-tlg. dt. Familiensatire von Dieter Wedel und Günter Handke.
Bruno Semmeling (Fritz Lichtenhahn) hat als Ingenieur in einer Hamburger Maschinenfabrik ein durchschnittliches Einkommen. Er und seine Frau Trudchen (Antje Hagen) haben die ständigen Mieterhöhungen satt und wollen ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen. Sie nehmen einen Kredit auf, beginnen mit dem Bau und erleben dabei nichts als Katastrophen. Hatte der bisherige Ärger nur ein einziges Gesicht, das des Vermieters (Herbert Steinmetz), hat der neue Ärger viele: Bauunternehmer Wumme (Günter Strack), Polier Knauster (Uwe Dallmeier), die Architekten Masch (Hans Korte) und Michels (Til Erwig) und viele andere. Alles geht viel langsamer als erwartet, und als Bruno wegen Betriebsferien in der Fabrik endlich Zeit hat, den Hausbau selbst zu überwachen, sind die Handwerker im Urlaub. Und alles wird viel teurer als erwartet. Neben der Miete zahlen die Semmelings bereits die monatlichen Abschläge für das neue Haus, und die müssen sie nun noch erhöhen, weil Trudchen immer nur teuerste Ausstattung anfordert, denn es ist ja für immer. Am Ende sind alle erschöpft, verschuldet, aber stolz, und so zieht Familie Semmeling mit Vater, Mutter und Kind endlich ins eigene Haus.
Die spielfilmlangen Geschichten um die Familie Semmeling liefen am Sonntagabend. Sie wurden mit ca. 27 Millionen Zuschauern ein sensationeller Erfolg und machten den jungen Regisseur Dieter Wedel bekannt. Er setzte seine Semmelings daraufhin noch zwei weitere Male in Szene: Vier Jahre später in Alle Jahre wieder: Die Familie Semmeling und 30 Jahre später (!) in Die Affäre Semmeling.
Eins plus eins gegen zwei
1971–1976. Verkehrsquiz mit Prominenten und Zuschauern als Kandidaten.
Als die Show startete, hatten Fragen zur Straßenverkehrsordnung gerade besondere Aktualität, denn am 1. März 1971 trat die neue StVO in Kraft. Aber auch noch Jahre später wurden unter erheblicher Anteilnahme des Publikums Themen wie Sicherheitsgurte, die 0,8 Promille-Grenze und Verkehrserziehung für Kinder behandelt. Eine Jury aus einem Psychologen und einem Mitarbeiter des Bundesverkehrsministeriums beaufsichtigte das Geschehen. Erster Moderator war Hans Rosenthal. Rosenthal wechselte nach kurzer Zeit zum ZDF, um Dalli Dalli zu moderieren, und Werner Zimmer übernahm.
Insgesamt liefen 34 Ausgaben, 30 bis 45 Minuten lang, zunächst etwa monatlich samstags, dann sonntagnachmittags.
Einsatz für Ellrich
2004 (RTL). Halbstündige pseudo-dokumentarische Krimiserie.
Kriminalhauptkommissarin Ilona Ellrich und ihre Kollegen Martin Scheidt und Jürgen Schönewald, alle echte Polizisten, ermitteln in frei erfundenen Fällen. Ulrich Wetzel, ein echter Richter, der bereits in der RTL-Show Das Strafgericht über fiktive Fälle entscheidet, stellt Haftbefehle aus. Alle sind unglaublich cool und ruppig, wie sie es bei ihren fiktiven Fernsehkollegen gelernt haben.
Seit Anfang der 90er Jahre geht Fernsehen in Deutschland normalerweise so: RTL führt ein neues Format zum Erfolg, und alle anderen kupfern es ab. Diesmal war es Sat.1, das das Format erfolgreich mit Lenßen & Partner und Niedrig und Kuhnt – Kommissare ermitteln etabliert hatte, und selbst der ZDF-Abklatsch Einsatz täglich – Polizisten ermitteln war schneller auf Sendung als die RTL-Version. RTL sendete zeitgleich zu Niedrig und Kuhnt werktags um 17.00 Uhr, war mit den Einschaltquoten jedoch schnell unzufrieden und beendete den Versuch nach fünfeinhalb Monaten.
Einsatz in Manhattan
1974–1991 (ARD); 1998 (RTL2). 118-tlg. US-Krimiserie von Abby Mann („Kojak“; 1973–1978).
Lieutenant Theo Kojak (Telly Savalas) klärt für die New Yorker Kriminalpolizei Verbrechen im südlichen Manhattan auf: Mordfälle, Rauschgiftdelikte, Korruption. Dabei geht er mit mehr Köpfchen als Waffengewalt vor und dehnt auch schon einmal die Gesetzestexte oder Anweisungen des Chefs ein wenig aus, um einen Fall zu lösen. Oft macht er sich unbeliebt, weil er gnadenlos auch gegen hohe Tiere ermittelt und ihm deren Ansehen egal ist. Kojak ist frech, zynisch, witzig, ein Gerechtigkeitsfanatiker und hat immer einen Lolli im Mund, meistens einen Hut auf dem Kopf und oft eine getönte Brille im Gesicht. Stets an seiner Seite ist sein Partner Barry Crocker (Kevin Dobson). Sein früherer Streifen-Partner Frank McNeil (Dan Frazer) ist jetzt sein Chef auf dem 13. Revier im südlichen Manhattan. Dort arbeiten außerdem die Detectives Stavros (Demosthenes Savalas; Tellys Bruder; er nannte sich ab der 3. Staffel George Savalas), Rizzo (Vince Conti), Saperstein (Mark Russell) und Prince (Borah Silver), die meist mit zur Lösung der Fälle beitragen, indem sie in den verschiedensten Rollen auch undercover ermitteln.
Kojak war ursprünglich nur die Hauptfigur eines einzelnes Fernsehfilms namens „Der Mordfall Marcus Nelson“ („The Marcus Nelson Murders“; 1973), der auf dem Roman „Justice In The Backroom“ von Selwyn Rabb basierte, bekam jedoch wegen seiner großen Popularität schnell seine eigene Fernsehserie, die ein internationaler Erfolg wurde. Den Film hatte die ARD kurz vor dem Serienstart im September 1974 gezeigt. Auch in Deutschland wurde Kojak einer der beliebtesten Krimihelden und sein Glatzkopf, der Lolli, an dem er dauernd lutschte, und der oft wiederholte Ausspruch „Entzückend!“ zu seinen Markenzeichen. Weltweit stieg im Zuge der Serie der Absatz von Lutschern deutlich an, in den USA um 500 Prozent! Die Straßen von Manhattan wurden als Sumpf des Verbrechens bekannt. Gedreht wurde die Serie größtenteils in Los Angeles – wie fast alle Serien, ganz gleich wo sie spielen. Außenaufnahmen mit dem typischen New Yorker Flair entstanden jedoch tatsächlich in Manhattan.
Bis 1978 zeigte die ARD 62 Folgen a 45 Minuten donnerstags um 21 Uhr, 1991 unter dem Titel Kojak – Einsatz in Manhattan 37 weitere Folgen im Vorabendprogramm. Ab 1989 entstanden in den USA sechs neue Fernsehfilme, die 1991 bei RTL unter dem einfachen Titel Kojak liefen (siehe dort). Unter diesem Titel liefen auch die noch übrigen 20 Folgen aus den 1970er Jahren bei RTL2.
Zur Serie erschien eine Romanheftreihe. Kojaks deutsche Synchronstimme war Edgar Ott.
Einsatz in vier Wänden
Seit 2003 (RTL). Vorher-Nachher-Show.
Stilberaterin Tine Wittler verschönert mit einem Handwerkerteam Privatwohnungen. Die Bewohner müssen für ein paar Tage ausziehen und werden anschließend mit neuen Möbeln und neu gestalteten Räumen überrascht.
Lief zunächst mit halbstündigen Episoden werktagvormittags. Ab Dezember 2003 wiederholte Vox die Reihe am Vorabend unter dem Titel Wohnen nach Wunsch — Einsatz in vier Wänden. Im September 2004 verlegte RTL die außerordentlich erfolgreiche Show ins Nachmittagsprogramm um 17.00 Uhr. Der bisherige Sendeplatz blieb ebenfalls bestehen, dort liefen nun Wiederholungen vom Vortag.
Ab Herbst 2005 wurden darüber hinaus einstündige Spezialausgaben in der Primetime gezeigt, in denen Tine Wittler keine Wohnungen, sondern gleich ganze Häuser aufmöbelte. Durch die zusätzliche Arbeit bekam Wittler Verstärkung für die wertägliche Nachmittagsshow, in der sie sich nun mit Almuth Kook und ab Mai 2006 auch noch Karima Ortani abwechselte. Schon bald waren fast nur letztere beiden zu sehen, aber auch nicht wesentlich später war kaum noch jemand zu sehen. Mitte August verschwand die Reihe aus dem Nachmittags- und Angang Oktober auch aus dem Vormittagsprogramm, jetzt war nur noch ein gerade erst dazugekommener Sendeplatz am Sonntagmittag übrig, der bis 2007 bestehen blieb.
Einsatz in vier Wänden – Spezial im Abendprogramm gab es aber weiterhin, staffelweise erst mittwochs, dann montags um 21.15 Uhr.