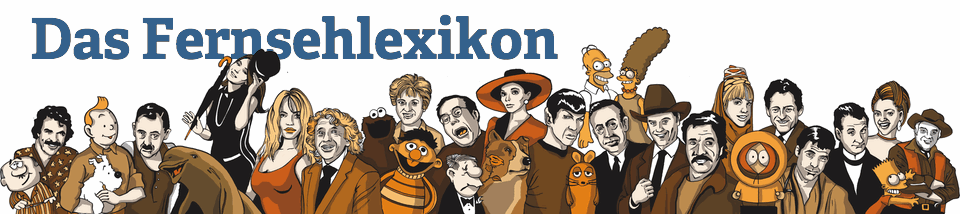Diese Drombuschs
1983–1994 (ZDF). 39‑tlg. dt. Familienserie von Robert Stromberger, Regie: Claus Peter Witt und Michael Meyer.
Vera (Witta Pohl), eigentlich Krankenschwester, und Siegfried Drombusch (Hans-Peter Korff) führen ein Antiquitätengeschäft in der Innenstadt von Darmstadt. Ihre Kinder Marion (Sabine Kaack; ab der sechsten Staffel: Susanne Schäfer) und Chris (Mick Werup) sind schon erwachsen, nur Nesthäkchen Thomi (Eike Hagen Schweickhardt) geht anfangs noch zur Schule und leistet später seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr. Chris ist Polizist, Marion schlägt sich zunächst mit wechselnden Tätigkeiten durchs Leben. Sie hat einen unehelichen Sohn namens Daniel (Jan Harndorf). Ihr Freund ist der Fotograf Gerd Schräpper (Peter Buchholz), später Dr. Peter Wollinski (Thomas Schücke). Oma Margarete Drombusch (Grete Wurm) lebt seit dem Tod ihres Mannes allein und leidet darunter, nicht mehr gebraucht zu werden. Vera und Siegfried träumen vom eigenen Haus und kaufen auf Vorschlag von Onkel Ludwig Burlitz (Günter Strack) die Alte Mühle vor der Stadt. Sie renovieren sie, ziehen ein und verlegen ihr Geschäft dorthin. Siegfried erleidet einen Herzinfarkt und stirbt in Folge 13.
Vera und Marion eröffnen in der alten Mühle zusätzlich zum Geschäft noch ein Lokal, das Onkel Ludwig führt. Ludwig, lange Zeit heimlich in Vera verliebt, offenbart ihr nun seine Liebe, ist und bleibt jedoch chancenlos. Vera kommt mit Dr. Martin Sanders (Michael Degen) zusammen. Chris heiratet Tina Reibold (Marion Kracht). Durch einen Unfall verliert die schwangere Tina ihr Baby und kann danach keine Kinder mehr bekommen. Zufällig lernen sie den kleinen Richy Streightner (Jacques Hipplewith) kennen, einen schwarzen Jungen, dessen Eltern bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen. Die beiden sorgen für ihn. Bei einem Polizeieinsatz im Fußballstadion wird Chris von Hooligans so schwer verprügelt, dass er in Folge 31 seinen Verletzungen erliegt. Tina führt einen langen Kampf mit dem Jugendamt, weil sie Richy adoptieren möchte, und darf den Jungen schließlich bei sich behalten.
Yvonne Boxheimer (Anja Jaenicke), die alle nur Yvonnche nennen, ist ein stummes Mädchen vom Rummelplatz, das bei Onkel Ludwig und dessen mütterlicher Freundin Frau Hohenscheid (Heidemarie Hatheyer) wohnt. Zum Ärger der Familie nimmt Ludwig auch Woody (Mathias Hermann) auf, der an der Prügelei mit Chris beteiligt war, den aber keine Schuld trifft, wie sich später herausstellt. Zu den Schuldigen gehört dagegen Yvonnches Bruder Karlheinz (Thomas Ahrens). Sowohl Yvonnche als auch Woody helfen im Lokal aus, außerdem hat Ludwig Marga Diebelshauser (Simone Rethel) als Bedienung eingestellt. Marion pachtet die „Katakomben“, eine heruntergekommene Spelunke, und macht ein ansehnliches Restaurant daraus. Der Anwalt Maximilian Lechner (Sigmar Solbach) ist ihr neuer Freund. Onkel Ludwig gibt das Lokal in der Alten Mühle an Hermann Eurich (Hans Weicker) ab, er selbst übernimmt auf dem Rummelplatz das Kasperltheater.
Vera scheint an den Schicksalsschlägen zu zerbrechen. Sie hat sich von Martin Sanders getrennt, wird depressiv, nimmt Medikamente und kommt ins Krankenhaus. Onkel Ludwig gelingt es, ihr neuen Lebenswillen zu geben, indem er das schwangere Yvonnche und ihren Freund Jürgen Baumert (Christian von Richthofen) in der Alten Mühle wohnen lässt und Vera so eine neue Aufgabe verschafft. Tatsächlich geht es ihr nach der Geburt von Yvonnches Baby wesentlich besser. Holger Kretschmar (Max Herbrechter) ist Tinas neuer Freund, sie trennt sich jedoch von ihm, als sie erfährt, dass er dafür verantwortlich ist, dass ihr Vater (Heinz Gerhard Lück) im Gefängnis sitzt. Holger wird daraufhin Koch in Marions „Katakomben“. Onkel Ludwig wandert nach Mauritius aus. Oma Drombusch, deren Freundin Frau Werbelhoff (Jane Tilden) seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt, wird langsam alt und verwirrt und benötigt Aufsicht. Vera überredet Marion, sich um Oma zu kümmern. Damit hat sie selbst jetzt keine Verantwortung mehr. Also reist Vera Onkel Ludwig nach Mauritius nach.
Die Familienserie der 80er‑Jahre schlechthin. Mit seinem schon bei den Unverbesserlichen demonstrierten einzigartigen Realismus zeigte Robert Stromberger das Alltagsleben einer normalen Familie zwischen Banalität und Schicksalsschlägen, zeigte Konfliktthemen wie Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Demonstranten oder den Umgang mit alten Menschen in all ihrer Komplexität und von verschiedenen Standpunkten, führte immer wieder schonungslos den Hang der Menschen zum Selbstbetrug vor.
Dabei war es manchmal schwer zu entscheiden, was unerträglicher war: das stumme Schweigen aller am Esstisch oder die endlosen Debatten der Beteiligten. Nicht untypisch ist dieser Dialog zwischen Vera und Siegfried, der ihr vorwirft, für Thomis Fünf in Mathe und die ungenügende Beaufsichtigung der Hausarbeiten verantwortlich zu sein – schließlich sei sie diejenige, die zu Hause ist. „Stimmt“, erwidert Vera. „Ich bin in der Tat samstags zu Hause. Während du aufregende Entspannung auf der Fußballtribüne suchst. Ich bin auch sonntags zu Hause. Während du beim strapaziösen Frühschoppen überparteiliche Beziehungen pflegst. Und besonders bin ich in der Woche abends zu Hause. Wenn du bei zeitungsträchtigen Vereinsfeiern die Partei vertrittst, bedeutungsvolles Blablabla machst und mit städteverschwisternden Damen charmierst. Das ist das Partnerschaftsbild der Jahrhundertwende!“ – „Ich möchte doch sehr bitten, ja? Du wirst die einträchtige Wechselbeziehung zwischen Politik und Geschäft nicht bestreiten wollen.“ – „Das tu ich auch gar nicht. Aber wo bleibt die Wechselbeziehung zwischen Vater und Sohn?“ Die ewig steifnackige, gut meinende und zu kurz kommende Vera hielt immer wieder endlose Moralpredigten mit Poesiealbum-Ratschlägen. Ihr enttäuscht-vorwurfsvoller Blick („Ist das fair?“) wurde für eine ganze Generation zur prägenden Fernseherfahrung.
Diese Drombuschs war eine der erfolgreichsten Serien des deutschen Fernsehens. So erfolgreich, dass sie der ARD einen „Drombusch-Schock“ verpasste: Die Folge vom 13. Januar 1992 schaffte den sagenhaften Marktanteil von 45 Prozent, und die Tagesschau schauten gleichzeitig so wenig Menschen wie noch nie. Das löste bei der ARD hektische Bemühungen aus, ihren eigenen Vorabend so populär wie irgend möglich mit eigenproduzierten Serien zu bestücken.
Die Folgen waren zunächst einstündig, hatten ab 1989 Spielfilmlänge und liefen immer zur Primetime.
Diese Koffer!
Man kann bei Galileo viel lernen. Zum Beispiel warum der Wind weht oder wie man Markenprodukte prominent in Magazinbeiträgen platziert. Nur seine Kenntnisse über einfache Mathematik sollte man vielleicht doch aus anderen Quellen beziehen.
Gestern stellte Galileo fest: „Billigflüge sind gar nicht mehr so billig“ und rechnete die Kosten für den Gepäcktransport beim sogenannten Billigflieger Ryanair wie folgt vor:
Für die Abfertigung mit einem Gepäckstück am Schalter sind immer 30 Euro fällig. Bei drei Gepäckstücken sind das schon 110 Euro.
Und nur 21 Stunden nach der Sendung steht das Video in genau diesem Wortlaut auch online. Zu hören gleich zu Beginn der Sendung nach etwa einer Minute in der Rubrik „100 Sekunden“. Die dauert vermutlich etwa drei Minuten.
Dingsda
1985–1998 (BR); 1987–2000 (ARD); 2001–2002 (Kabel 1). Also, das ist so ’ne Sendung, in der da so Kinder, die so zwischen fünf und neun Jahre alt sind, Sachen umschreiben tun. Und dann sind da noch so Promi…, Promi…, also, Leute, die wo man kennt, und die müssen raten, was die Kinder da so meinen. Der nette Moderator von „Uups“, das ist der Fritz.
Erfolgreiche 45-Minuten-Quizshow mit Fritz Egner, der mit der Sendung bekannt wurde. Vier prominente Kandidaten müssen in Zweierteams die Umschreibungen erraten, die der BR zuvor in Kindergärten und Grundschulen aufgezeichnet hat und nun auf einem Großbildschirm zu sehen sind. Rutscht dem erklärenden Kind der gesuchte Begriff heraus, wird er in der Sendung mit einem „Uups“ übertönt. Die Kandidaten raten einzeln der Reihe nach. Liegt der Erste falsch, ist ein Spieler des anderes Teams dran und hört dafür eine neue Beschreibung zum gleichen Begriff. In der Schnellraterunde bekommt derjenige den Punkt, der den Film als Erster mit dem Buzzer anhält und die richtige Lösung nennt.
Das Format stammt von „Child’s play“, einer täglichen Gameshow, die ab September 1982 beim US-Sender CBS lief, aber nur ein Jahr überlebte. Die deutsche Version war im Dritten Programm des Bayerischen Fernsehens gestartet. Nach einem zunächst einmaligen Test in der ARD im Juni 1987 wurde sie ab Januar 1988 dauerhaft ins Erste übernommen und lief dort über Jahre einmal im Monat dienstags um 20.15 Uhr. Als Egner nach 132 Ausgaben zum ZDF wechselte, übernahm Werner Schmidbauer ab Juli 1994 die Moderation. Der Erfolg hatte inwischen nachgelassen und die Show den Weg ins Vorabendprogramm um 18.55 Uhr gemacht. Eine weitere Staffel wurde wieder im Bayerischen Fernsehen erstausgestrahlt, dann abermals verlegt, zurück ins Erste, diesmal ins Nachmittagsprogramm am Freitag um 16.00 Uhr und auf 25 Minuten gekürzt. Dort lief Dingsda noch eine Weile unauffällig vor sich hin, bis Ende 2000 ebenso unauffällig die letzte Sendung ausgestrahlt wurde.
Nur knapp ein Jahr später legte Kabel 1 das Spiel neu auf (der kleine Sender hatte ein Jahr zuvor bereits erfolgreich die alte ARD-Show Was bin ich? wiederbelebt). Thomas Ohrner war der Moderator, und jetzt traten jeweils zwei Schulen oder zwei Kindergärten, aus denen die erklärenden Kinder stammten, gegeneinander an. Jeweils ein erwachsener Vertreter daraus spielte mit einem Prominenten im Zweierteam. Dingsda lief damit wieder zur Primetime, mittwochs um 20.15 Uhr, sogar wöchentlich, und war eine Stunde lang. Der Erfolg kam nicht zurück. Trotz enttäuschender Quoten versuchte Kabel 1 eine zweite Staffel, diesmal am als Gameshow-Tag etablierten Donnerstagabend. Die Quoten waren noch schlechter, und der Sender stellte die Produktion ein.
Dinner for One oder Der 90. Geburtstag
1963 (ARD). Sketch von Lauri Wylie.
Diese Sendung ist weder eine Serie noch eine Reihe, läuft jedoch in so schöner Regelmäßigkeit, dass sie fester Bestandteil des Fernsehens ist – es ist die am häufigsten wiederholte Fernsehsendung in der Bundesrepublik.
Die alte Miss Sophie (May Warden) feiert ihren 90. Geburtstag allein mit ihrem Butler James (Freddie Frinton), der reihum Sophies bereits verstorbene Freunde Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom vertreten und jeweils in ihrem Namen auf Miss Sophie trinken muss. James wird immer betrunkener und fällt regelmäßig über den Tigerkopf-Teppich.
Der 18-minütige Schwarz-Weiß-Sketch ist eine deutsche Produktion mit englischen Darstellern in englischer Sprache. Frinton besaß die Rechte an dem 1948 verfassten Sketch, er hatte sie dem Autor abgekauft. Er war zum ersten Mal bereits am 8. März 1963 in der Sendung „Guten Abend, Peter Frankenfeld“ zu sehen. Frankenfeld und der Regisseur Heinz Dunkhase hatten Frinton und Warden mit dem Sketch bei einem Besuch im englischen Blackpool entdeckt und sofort verpflichtet. Der NDR nahm ihn kurz darauf noch einmal neu auf, als eine der ersten MAZ-Produktionen der deutschen Fernsehgeschichte, und strahlte ihn in dieser Fassung erstmals am Samstag, 8. Juni 1963 um 21.30 Uhr in der ARD aus. Diese ist zugleich die seitdem regelmäßig wiederholte Fassung. Frinton hatte sich geweigert, den Sketch in deutscher Sprache aufzuführen, war aber 1968 zu einer Neuverfilmung in Farbe bereit. Dazu kam es nicht, drei Wochen vor dem geplanten Aufzeichnungstermin starb Frinton.
Ansager Heinz Piper erklärt zu Beginn der Sendung den groben Verlauf der nachfolgenden Szene, den ständig wiederkehrenden Wortwechsel „The same procedure as last year, Miss Sophie?“ – „The same procedure as every year, James“, und weist darauf hin: „Das weitere Gespräch ist nicht interessant, es ist völlig ohne Belang.“
Ab 1972 lief der Sketch jedes Jahr am Silvesterabend in allen Dritten Programmen. Damit erhielt der Satz „The same procedure as last year“ noch eine zweite Bedeutung. Eigentlich hatte Heinz Piper bei der Aufzeichnung gesagt: „The same procedure than last year“, was natürlich grammatisch falsch ist und regelmäßig Proteste von Englischlehrern auslöste. Seit 1988 war der Satz daher nicht mehr zu hören. Der NDR schnippelte ein wenig in der Tonspur herum und klebte Herrn Piper ein „as“ auf die Lippen, das er in einer Probeaufzeichnung gesagt hatte.
Silvester 1999 strahlte der NDR erstmals drei Versionen aus: eine nachgespielte auf Plattdeutsch, eine nachkolorierte und die Originalfassung. Die Anzahl der Ausstrahlungen nahm nun schlagartig zu, als sich die Sender nicht mehr damit begnügten, den Sketch nur jeweils einmal zu zeigen, sondern ihn gleich mehrfach am Silvestertag sendeten, und auch der Ki.Ka einstieg, der zudem eine Fassung „Dinner für Brot“ mit Bernd, dem Brot, produzierte. Am 31. Dezember 2003 wurde Dinner For One 24-mal gezeigt, der bisherige Rekord. Ein Jahr später, also einundvierzigeinhalb Jahre nach der Erstausstrahlung, feierten mehrere Dritte Programme „40 Jahre Dinner For One“. An diesem Abend sahen in der Summe mehr als 15 Millionen Menschen zu.
In Großbritannien ist die Sendung praktisch unbekannt.
Diplomaten küsst man nicht
1987-1988 (SR). 20-tlg. dt. Comedyserie.
Klassische Verwechslungskomödie: Weil Oberamtsrat Carl-Friedrich Schleicher (Siegfried W. Kernen) seinen Papierkram nicht im Griff hat, wird im Auswärtigen Amt in Bonn die Bewerberin für die freie Stelle der Küchenchefin, Gundula Schmidt (Corinna Genest), versehentlich auf die ebenfalls freie Stelle der stellvertretenden Protokollchefin gesetzt. Protokollchef von Bösecken (Hans Peter Korff), Verwaltungschef Schulz-Piffel (Walter Hoor), Staatssekretär Hasenclever (Uwe Friedrichsen) und Chefsekretärin Juliane Diependonck (Trees van der Donck) merken nix, haben dafür aber lustige Nachnamen, Frau Schmidt hält ihren Mund, und wie beabsichtigt geht alles drunter und drüber.
Die halbstündigen Folgen liefen im regionalen Vorabendprogramm der ARD. Im Bereich des Saarländischen Rundfunks waren sie bereits einige Tage vorher in Südwest 3 zu sehen.
Dirty Dancing
1989 (DFF2). 13-tlg. US-Liebesserie (“Dirty Dancing”; 1988–1989).
Der Tanzlehrer Johnny Castle (Patrick Cassidy) war Nachwuchskoordinator in Kellerman’s Sommer Camp, bis Besitzer Max Kellerman (McLean Stevenseon) seiner Tochter Frances, genannt Baby (Melora Hardin), diesen Job gab. Baby und Johnny verlieben sich, und Johnny bringt Baby „Dirty Dancing“ bei. Seine eigentliche Tanzpartnerin ist Penny (Constance Marie). Robin (Mandy Ingber) ist Babys Cousine.
Die Serie basierte zwar auf dem gleichnamigen Erfolgsfilm mit Patrick Swayze und Jennifer Grey, verdrehte aber ein paar Konstellationen. So war Baby im Film mit ihren Eltern im Sommerurlaub bei Kellermans, in der Serie waren die Eltern geschieden und ihr Vater selbst der Besitzer. Filmschwester Robin war hier ihre Cousine. Aus dem Film war kein Schauspieler dabei. Ab Dezember 1989 zeigte auch RTL die halbstündigen Folgen am Samstagnachmittag.
Disco
1971–1982 (ZDF). „Hits und Gags mit Ilja Richter“. 45-minütige Popmusikshow mit Ilja Richter, dem damals jüngsten Entertainer im deutschen Fernsehen. Richter war 18 Jahre alt, als die Reihe begann. Seit er 16 war, hatte er bereits 4-3-2-1 — Hot And Sweet moderiert, dessen Nachfolgesendung Disco war.
Disco lief alle vier Wochen samstags, zunächst um 18.45 Uhr, dann um 18.00 Uhr, ab 1975 wegen des großen Erfolgs näher am Hauptabendprogramm um 19.30 Uhr. Interpreten spielten im Studio ihre aktuellen Hits, die Bandbreite reichte von Julio Iglesias und Michael Holm bis zu Deep Purple und den Rolling Stones.
Internationale Stars, die nicht in die Sendung kamen, waren in Videoeinspielungen mit ihren Songs zu sehen. Ein weiterer Einspielfilm porträtierte pro Ausgabe ausführlich einen Star. Dazu gab es gesungene und gespielte Sketche mit Ilja Richter und Gästen, die teils live, teils vorproduziert waren. Neben den Gästen war Richters Schwester Janina regelmäßige Sketchpartnerin. Bei einem Quiz konnten die Fernsehzuschauer als Hauptpreis einen Besuch in der nächsten Sendung gewinnen.
Jede Sendung begann zunächst mit dem Auftritt einer Band, bevor Richter zum ersten Mal die Bühne betrat. Zu Begrüßung rief er: „Hallo Freunde!“, und das Studiopublikum rief zurück: „Hallo Ilja!“ Wenn der Gewinner des Preisrätsels bekannt gegeben wurde, rief Richter: „Licht aus“ (und alle riefen: „Whom! “) – „Spot an!“ (alle: „Yeah! “), und ein verschüchtertes Etwas saß vor den Augen der Öffentlichkeit zaghaft winkend im Lichtkegel.
Disco wurde die mit Abstand populärste Musiksendung des westdeutschen Fernsehens. Zur Überraschung aller Beteiligten war die Sendung nicht nur bei der anvisierten Zielgruppe der Teenager ein großer Erfolg, auch viele ältere Menschen schauten zu. Der anfängliche Untertitel „Musik für junge Leute“ wurde nach dieser Erkenntnis ab 1973 gestrichen, ältere Zuschauer wurden sogar gezielt ins Studio eingeladen. Jeder Besucher bekam eine „Aufwandsentschädigung“ von 25 DM.
Insgesamt schalteten durchschnittlich 20 Millionen Menschen ein. Das verwundert angesichts der obskuren Mischung der auftretenden Künstler ebenso wie im Hinblick auf die Qualität der Comedyeinlagen. Die Sketche zeichnete eine verheerende Experimentierfreude mit der neuen Technik der Blue Box aus, die Moderationen ein skrupelloser Hang zum Kalauer um jeden Preis. In einer Sendung sagte Richter, offenbar motiviert durch die Olympischen Spiele in München: „Als Moderator fuhr er hin, als Champignon kam er zurück. Um mit den Olympischen Ringen zu sprechen: O, O, O, O und O. Das Publikum hat die Tribünen voll gemacht, und alle haben ’ne Fahne.“
Spontane Gespräche mit den Bands begannen gern damit, dass der Moderator sich von einer Sängerin fragen ließ, wie er heiße, und er antworte. „Ilja. Riecht er?“ Richter war zwar jugendlich-locker, was seinen Moderationsstil anging, unterschied sich aber von anderen Jugendmoderatoren durch seine Kleidung, die völlig unjugendlich stets aus einem korrekten Anzug mit Fliege bestand. Natürlich war Richter viel zu dürr, als dass dieser hätte ordentlich sitzen können.
Der Sendetitel beinhaltete noch die jeweils auf zwei Stellen gekürzte aktuelle Jahreszahl, z. B. Disco ’76. Insgesamt liefen 133 Ausgaben. Nach dem Ende der Reihe war auch Richters Fernsehkarriere im Alter von 29 Jahren weitgehend zu Ende. Er wirkte zwar danach in vielen Shows, albernen Filmen oder Bühnenstücken mit, bekam aber nie wieder eine eigene regelmäßige Sendung. Im Sommer 1994 liefen als Das Beste aus Disco sechs Zusammenschnitte seiner Erfolgsshows im ZDF.
Disharmonica
Wenn Monica Lierhaus sich selbst interviewen könnte, ginge das wahrscheinlich ungefähr so:
Lierhaus: „Erstmal Glückwunsch zu dem fantastischen Interview, das Sie heute geführt haben. Wie fühlen Sie sich jetzt?“
Lierhaus: „Ja, gut, sicherlich, ich sag mal, ich war prima vorbereitet, hab‘ das Spiel, um das es ging, sogar gesehen, und dann im richtigen Moment die richtigen Fragen gestellt.“
Lierhaus: „Aber um noch mal auf Ihre letzten zwölf Interviews zu sprechen zu kommen: Warum waren die alle so entsetzlich?“
Lierhaus: „Ja, gut, sicher, da war ich nicht in Form, die Abstimmung hat nicht gestimmt, das war ärgerlich, so etwas sollte nicht vorkommen, kann aber natürlich schon mal passieren, und deshalb bin ich heute sehr, sehr froh, das es diesmal so gut geklappt hat.“
Lierhaus: „Die waren nämlich wirklich ganz, ganz furchtbar.“
Es ist schade, dass Monica Lierhaus eine halbe Stunde nach dem Abpfiff eines erfolgreichen Spiels, das die deutsche Nationalmannschaft nach einer tollen Leistung diesmal sogar verdient in die nächste Runde gebracht hat, für den richtigen Zeitpunkt hält, die beiden Trainer noch einmal ausgiebig nach den unbefriedigenden Spielen gegen Kroatien und Österreich zu befragen. Im portugiesischen Fernsehen hätte man in der gleichen Situation wahrscheinlich nur den Reporter mit den Trainern zu lauter Musik singen und tanzen gesehen. Aber da die Spieler in den Interviews herausstellten, dass die deutschen Tugenden sie zum Sieg geführt haben, wollte Lierhaus mit der anderen deutschen Tugend, so oft wie möglich schlechte Stimmung zu verbreiten, wohl nicht hinter dem Berg halten.
Wenn das Ergebnis gereicht hat, kann man die Fehleranalyse des Vorhergegangenen doch auf später verschieben. Man nehme sich ein Beispiel an der CDU, die die letzte Bundestagswahl vor drei Jahren viel knapper als erwartet gewonnen und die Fehleranalyse auf später verschoben hatte, einen Zeitpunkt, der bis jetzt nicht gekommen ist, denn gerade läuft’s ja.
Immerhin Gerhard Delling und Günter Netzer lobten die Mannschaft „über den grünen Klo“ (Zitat Delling).
Und es gab noch weitere gute Nachrichten: Diesmal pfiffen wieder Schiedsrichter das Spiel anstelle der komplett blinden Comedytruppe vom Montag, deren Ansicht vom Spielgeschehen einen höheren Humorwert hatte als Ingolf Lücks Nachgetreten und die noch zu blöd waren, um parteiisch zu sein. Und der Kommentator Tom Bartels hatte diesmal ebenfalls frei.
(Sehen Sie, ich lasse mich auch schon von Monica Lierhaus‘ Nachkarten anstecken. Pfui. Schluss jetzt. Tanz auf den Tischen! — Halt, geht nicht, da sind gar keine Tische, sagte Podolski ganz sachlich.)
Ach, und könnte bitte bis nächsten Mittwoch mal jemand das RTL-Team von Mein Garten ins Stadion nach Basel schicken, um dieses Rasenmosaik aufzuhübschen?
Disney Club
1991–1995 (ARD). 90-minütige Unterhaltungsshow für Kinder am Samstagnachmittag.
In der Show, in der Kinder als Studiopublikum anwesend waren, gab es Spiele, Auftritte von Sängern, Bands und Sportlern und viele Einspielfilme, Reportagen und Serien, z. B. Chip & Chap – Die Ritter des Rechts, Disneys Gummibärenbande und Duck Tales – Neues aus Entenhausen mit den beliebten Disney-Zeichentrickfiguren. Die Reportagen waren teils Eigenproduktionen, teils in den Disney-Parks gedrehte Übernahmen aus der US-Version der Show namens „Mickey Mouse Club“. Moderiert wurde die Show von Ralf Bauer (bis März 1993), Antje Pieper (bis Juni 1994) und Stefan Pinnow. Nach Ralfs Ausscheiden schrumpfte das bisherige Moderatoren-Trio zum Duo. Auf Antje folgte Judith Halverscheid.
Mitte der 90er‑Jahre verlor die ARD die Rechte an den Disney-Serien an RTL, woraufhin die Reihe nach 261 Ausgaben in Tigerenten-Club umbenannt, aber konzeptionell kaum verändert wurde. Antje Maren Pieper wurde später Reporterin beim ZDF und Moderatorin des Länderspiegel, Ralf Bauer wurde Schauspieler, u. a. in Gegen den Wind, Pinnow Moderator des Boulevardmagazins taff und Halverscheid Pinnows Frau. Zum US-Ensemble hatten Britney Spears, Justin Timberlake und Christina Aguilera gehört.
Dittsche
Seit 2004 (WDR). „Das wirklich wahre Leben“. Improvisations-Comedy von und mit Olli Dittrich.
Der 40-jährige Hamburger Arbeitslose Dittsche (Olli Dittrich) schlappt regelmäßig in Bademantel und Jogginghose zur „Eppendorfer Grill-Station“, seinem Stammimbiss, um die leeren Bierflaschen in seiner Tüte gegen volle auszutauschen. Während er die ersten zwei Flaschen gleich am Tresen leert („Kerl, das perlt aber heute wieder“), verwickelt er Imbisswirt Ingo (Jon Flemming Olsen) in ein Gespräch über Gott und die Welt, in dem er aus Brocken von „Bild“-Überschriften und halb verstandenen Fernsehberichten schwindelerregende Gedankengebäude errichtet und dem Begriff „gefährliches Halbwissen“ eine konkrete Dimension gibt. In den Worten von Ingo: „Das ist dein Problem: Du hörst viel, aber weißt nichts.“
Mühelos schafft Dittsche es, einen Bogen von der angeknacksten deutsch-italienischen Freundschaft zum Verfallsprozess von Kartoffelsalat zu schlagen oder von den „Ausdünstungen“ der Würstchen über „Dispersitionsfarbe“ zu den Bochumer Tauben, die alle schwul geworden sind. An einem Stehtisch trinkt derweil Stammgast Schildkröte (Franz Jarnach alias Mr. Piggi) schweigend sein Bier. (Er heißt „Schildkröte“, weil ihm sein Schwager aus der DDR eine Krokodilimitat-Jacke geschenkt hatte, mit der er aussieht wie ein Ninja Turtle aus einem Überraschungsei.)
Dittsche besteht aus nichts als dem Gespräch im Imbiss, gefilmt scheinbar von Überwachungskameras in farbarmen Beigebrauntönen. Es gibt kein Drehbuch, das meiste ist improvisiert, was die Situation zusammen mit Dittrichs Verwandlungstalent beängstigend realistisch wirken lässt. Dittsche ist eine innovative Satire, die nicht von Pointen lebt, sondern von der Genauigkeit, mit der sie die Absurdität des Lebens abbildet, vergleichbar mit Blind Date. Die Figur des Dittsche stammt aus Dittrichs ZDF-Reihe Olli, Tiere, Sensationen. Die Folgen der ersten Staffel wurden mit so kurzem Vorlauf produziert, dass er Stellung nehmen konnte zu den aktuellen Themen der Woche. Seit der zweiten Staffel wird live gesendet. Als Stargäste kamen u. a. Wladimir Klitschko, Rudi Carrell und Uwe Seeler vorbei.
Dittrich hatte es lange schwer, für diese spröde und kompromisslose Form einen Sender zu finden; der WDR räumte ihm schließlich am Sonntagabend um 22.30 Uhr ein Plätzchen frei und wurde mit einer überschaubaren, aber treuen Fangemeinde belohnt. Mit der neunten Staffel 2008 musste Dittsche den etablierten Platz räumen. Angesichts der Wahl, in der Nacht oder am Samstag zu senden, wählte Dittrich notgedrungen den Samstag. Die ARD wiederholte die Folgen ab Februar 2005 jeweils am folgenden Tag gegen 0.30 Uhr — mit erstaunlich guten Einschaltquoten. Auch im NDR und im HR lief die Reihe.
2004 wurde Dittsche als beste Comedy mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet, 2005 mit dem Grimme-Preis mit Gold. Die Titelmusik ist „Stand By Your Man“ von Tammy Wynette.