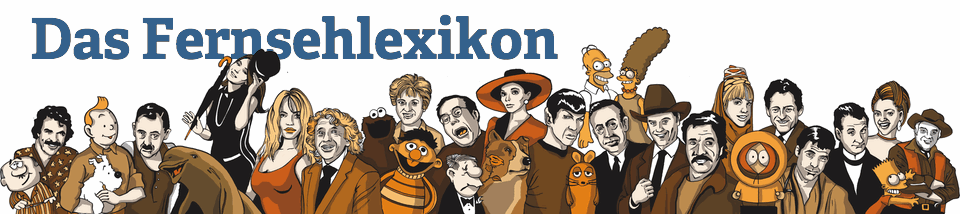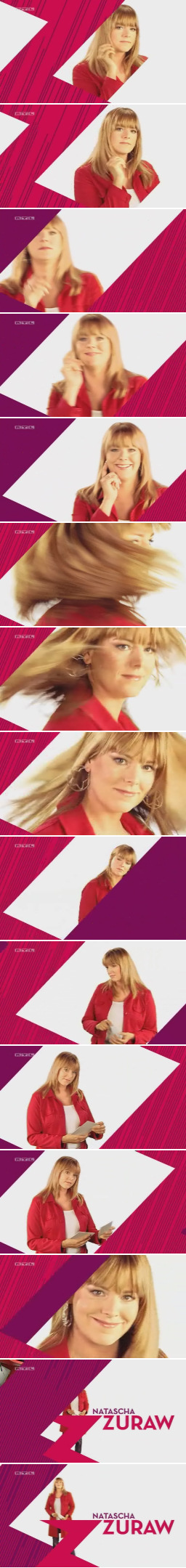Dem Autor Orkun Ertener verdankt das Fernsehen den überdeutschen türkischen RTL-Ermittler Sinan Toprak, den knurrigen Kieler Tatort-Kommissar Klaus Borowski — und die atemberaubende und preisgekrönte Krimiserie KDD — Kriminaldauerdienst. Ab Freitag zeigt das ZDF die zweite Staffel der nicht nur für ZDF-Verhältnisse außergewöhnlichen Serie. Ein Werkstattgespräch.
Woher kam die Idee zu Kriminaldauerdienst?
Orkun Ertener: Vor vielen Jahren, ungefähr 2002, haben mich die Produzenten Mischa Hofman und Kathrin Breininger gefragt: Hast du nicht Lust, eine authentische, aber billige Krimiserie zu schreiben? Ich war schon damals Liebhaber von amerikanischen Ensemble-Stücken und hatte das Gefühl, das haben wir im deutschen Fernsehen noch gar nicht: diese horizontalen Erzählstrukturen mit Geschichten, die sich über mehrere Folgen erstrecken. Ich wollte gerne ein Medical Drama mit einem Police Drama kombinieren, so etwas wie E.R. auf der Polizeiwache. Und dann haben wir lange daran entwickelt.
Eine „billige“ Krimiserie?
Eine kostengünstige. Es ist dann aber doch eine eher teure, gut ausgestattete Produktion geworden.
Aber was heißt der Auftrag „billig“ für einen Autor?
Zum Beispiel wenig Aufmerksamkeit in abstürzende Polizeihubschrauber zu legen, sondern auf den Dialog: ein echtes Drama.
Wie kam das ausgerechnet ins ZDF?
Der Redaktion, Klaus Bassiner und Axel Laustroer, hat das Pilotbuch, das wir ohne Senderauftrag entwickelt hatten, gefallen, nach der Legende hat es dann auch der Programmdirektor irgendwann im Flieger gelesen und gesagt: Wir machen das. Am Anfang gab es noch den Plan, es mittwochs zu senden, auf dem Platz, an dem Kanzleramt untergegangen ist — was nach meiner Vermutung KDD genauso ergangen wäre. Dann entschied das ZDF, das am Freitag laufen zu lassen…
… auf dem traditionellen Platz für die biedersten Krimis im deutschen Fernsehen.
Das ist sehr, sehr zweischneidig. Einerseits glaube ich wirklich, wir wären am Mittwoch untergegangen. Andererseits ist die erste Staffel am Freitag kaum wahrgenommen worden. Das ZDF hat, glaube ich, zu wenig kommuniziert: Das ist zwar der Termin, auf dem auch Der Alte läuft, aber was dann kommt, Kinder, ist was ganz anders — Publikum mit Herzbeschwerden bitte abschalten, die anderen bitte zuschalten. Es gab dann bei Quoten auch eine richtige Kurve nach unten.
Woran lag das?
Das ist schon ein Kulturschock. Es ist kein Wunder, dass viele traditionelle ZDF-Krimi-Zuschauer abschalten; es müssten aber andere hinzukommen, und das ist in der nicht ausreichend passiert. Aber wenn man das besser kommuniziert, was bei der zweiten Staffel mehr geschieht, ist der Freitag gar nicht schlecht.

Foto: ZDF
War KDD als Berlin-Drama konzipiert?
Nein. Ich hatte viel hier in Köln recherchiert und wollte das hier auch erzählen. Ich dachte, Berlin könnte zu klischiert sein, bei den Geschichten, die ich erzählen wollte. Das ZDF fand aber, dass Köln ein bisschen abgefilmt ist. Was kommt dann in Frage? Kreuzberg, Neukölln — immer noch mit großen Ängsten von mir begleitet. Aber das hat sich als großartige Senderentscheidung erweisen. Ich würde heute sagen, das könnte nirgends anders spielen — obwohl viele Geschichten gar nicht von dort kommen.
Vieles an KDD ist ungewöhnlich. Zum Beispiel erzählen Sie realistisch anmutende soziale Dramen, entscheiden sich aber im Zweifelsfall für den größeren Knall, den besseren Unterhaltungswert.
Ja. Mir war die Dramaturgie oft wichtiger als Realismus oder die Anmutung von Authentizität. Wir reden von Fiktion, nicht Dokumentation.
Andererseits ist es kein Märchen, die Geschichten wirken echt.
So gut wie jeder Kriminalfall in KDD ist wahr. Ich möchte erfahren: Wie können Menschen sein? Was passiert ihnen? Ich war für ein paar Tage hier beim KDD, um zu sehen: Wie sind die, was reden die, wann kriegen die glänzende Augen? Dann erzählen die diese unglaublichen Geschichten wie die von der Mutter, die behauptet, ihr Kind sei entführt worden – dabei hatte sie es nur erfunden, um jahrelang Sozialleistungen zu bekommen. Wenn sechs, sieben Leute da arbeiten und ihnen solche Geschichten begegnen, und jeden Tag eine neue: Was macht das mit denen? Das ist die Grundfrage, der Motor der Serie.
Die ganze Geschichte mit dem erfundenen Kind ist eine von vielen Miniaturen in KDD. Sie ist, alles in allem, vielleicht fünf Minuten lang.
Höchstens.
Sie tippen das nur einmal an und sagen: Ich habe hier folgende Geschichte. Die führt aber nicht irgendwo hin, sondern funktioniert als Pointe.
Ja. Viele Geschichten, nicht alle, sind auf einen überraschenden Moment hin erzählt. Das Erzählkonzept beruht aber auch darauf zu sagen: So ist es da ja im Kriminaldauerdienst, die die Fälle nur am Anfang bearbeiten und dann weitergeben. Aber so ist es in unserem Leben und unserer aller Arbeit ja auch oft: Man hat nur einen Eindruck, kann kurz auf etwas reagieren, und das war’s. Ich wollte die Splitter zeigen, ohne die Geschichte von vorne bis hinten zu erzählen und zu wissen, wie sie moralisch zu bewerten ist. Das ist ein Anspruch von mir: nicht zu moralisieren, sondern moralische Fragen aufzuwerfen.
Im „Tatort“ hätte die Kindesgeschichte allein 90 Minuten gefüllt.
Es gibt eine bestimmte Erzähltradition beim Tatort, zum Glück nicht die einzige, die ich ganz entsetzlich finde. Da werden Dinge zerdehnt und bewertet und dadurch verlieren sich die Impressionen, die bohrende Fragen, die sie auslösen können.
Bei manchen dieser Miniaturen habe ich mich gefragt, ob das nicht auch etwas Frivoles hat – kurz das Elend von Personen zu zeigen, die man dann sofort wieder aus den Augen verliert, nur um eine Pointe zu setzen.
Das ist in der Tat eine berechtigte, hochmoralische Frage. Da ist diese ganz kurz erzählte Geschichte mit der Frau, die Krebs hat und aus Geldgründen, ihrer Familie zuliebe, Selbstmord begeht. Ich finde, diese Figur ist ernsthaft erzählt und auch so inszeniert. Dann darf man sie auch benutzen: Wenn man das Gefühl hat: Es sind nur 20 Sekunden, aber es ist ein wahrhafter Augenblick. Und es gibt ein paar wirklich wahrhafte Momente in KDD.

Foto: ZDF
KDD hat aber auch etwas von einer Seifenoper. Manchmal übertreiben Sie es mit den Geschichten und den Knalleffekten, die Sie Ihren Figuren zumuten. Ist es gefährlich, mit den Figuren so frei spielen zu können?
In der ersten Staffel haben wir experimentiert, manchmal mit einer kindlichen Freude, die Formen auszuprobieren. Die Figuren haben alle eine Macke: Der eine verliert die Tochter, der andere muss mit seinem Alkoholismus kämpfen. In der Anhäufung ist das schon gefährlich. Vielleicht war da auch die Angst, dass das womöglich die einzige Staffel ist, die es geben wird — ich will da alles erzählen. Sonst hätte man es eher wie bei amerikanischen Vorbildern gemacht, die sagen: Den Charakter können wir auch in Staffel sieben noch zum Tablettenabhängigen machen. Aber in der Zukunft heißt es für KDD vielleicht auch, die Häufung von persönlichen Schicksalsschlägen wieder ein bisschen zurückzunehmen.
Ist denn eine dritte Staffel schon sicher?
Ja, es gibt einen Auftrag, und ich sitze gerade an der Entwicklung. Gut, falls die Quoten miserabel sind,stellen sich vielleicht wieder Fragen.
Ist das normal, dass ein Sender das vorab in Auftrag gibt? Schon die zweite Staffel war angesichts der Quoten ja keine Selbstverständlichkeit.
Sie haben zum Glück nach den ersten drei oder vier Folgen entschieden, da war der Schnitt noch okay.
Es hat gerade gereicht.
Ja. Und die gute Presse hat sicher geholfen und später die Preise. Es ist eine Art ungeliebtes Wunderkind: Eigentlich möchten das alle machen, aber es hat noch nicht den Quotenauftrag erfüllt.

Foto: ZDF
Die erste Staffel endet dramatisch offen: Einer völlig misslungenen Aktion, an deren Ende das ganze Personal im Blut liegt. Das wirkt, als wollten Sie sich die Möglichkeit offen lassen, das halbe Ensemble auszutauschen.
Nein, das war keine Option. Es war aus dramaturgischen Gründen klar, dass Rainer Sallek (Christian Redl) stirbt. Aber sonst niemand. Und die Figur des internen Ermittlers Stieglitz war schon lange vor der Besetzung meine Lieblings-Nebenfigur, dann kam Michael Rotschopf als Schauspieler, und der ist so großartig, der muss auf jeden Fall am Leben bleiben.
Aber Sie hatten auch einfach kindliche Lust, mit dem fiesestmöglichen Cliffhanger aufzuhören, oder?
Ja, aber wir wollten auch sagen: Es hört noch nicht auf, Kinder, es geht weiter. Wir haben Zeit — wir haben uns sehr gehetzt in der ersten Staffel, aber es kommt eine zweite. Ich möchte den Figuren lange nachgehen und versuchen, so ernst wie möglich zu erzählen, wie sie in dieser Zeit sind. Es gibt da die Kristin, die Saskia Vester spielt, das ist eine alte Figur: Ich habe bei Recherchen für Stahlnetz mit einer Polizistin über Mobbing bei der Polizei gesprochen, und da fiel der Nebensatz: Und wenn man jetzt noch lesbisch wäre, das wäre tödlich. Aus so einem Satz entsteht manchmal eine ganze Figur: Was wäre wenn? Vielleicht würde man in anderen Serien erst einmal nur diese Geschichte erzählen und die anderen Polizisten wären eher unauffällig — bei KDD ist es so, dass jede einzelne Figur so einen interessanten Kern hat.
Die lesbische Polizistin hat sich aber vorerst mal einen Mann gesucht. Es gibt die Kritik, dass hinter der modernen Fassade von KDD ein sehr konservatives Weltbild stecke. Finden Sie das eine legitime Kritik?
Grundsätzlich nein. Andererseits ist es natürlich so, dass zum Beispiel in 24, einer Serie, die ich dramaturgisch unglaublich toll finde, ein Weltbild transportiert wird, das mich zum Kotzen bringt. Schon das Szenario der permanenten Bedrohung, und es gibt nur die Lösung durch Gewalt. Ich glaube aber nicht, dass in KDD eine Lebensart diffamiert und eine andere gefeiert wird. Wir zeigen: Es gibt Gewalt. Es gibt auch eine Gewaltbereitschaft bei Polizisten. Aber da wird keine Ideologie transportiert.

Foto: ZDF
Sind Sie jetzt angefixt, was das Serien-Schreiben angeht?
Vor vier, fünf Jahren, habe ich gedacht: Die Serie ist die Königsdisziplin des Fernsehens, und ich möchte das gerne machen. Eigentlich ist das auch jetzt noch so — theoretisch. Aber die letzten Jahre frage ich mich: Was soll ich hier erzählen? Alles, was mich interessiert, floppt. Ich habe das Gefühl, als befänden wir uns in einer Beerdigungsphase: das Ende der Fiktion. Es gab ein Projekt, auf das ich viel Lust hatte, eine Krankenhausserie, sehr realistisch erzählt, auch ein bisschen ambitionierter (was auch immer das heißt). Ich habe lange recherchiert, war im Krankenhaus, und es waren auch schwere Geschichten: Wenn Kinder sterben, ist das nicht so schön. Der Sender hat dann irgendwann gesagt, so schwer geht das nicht. Nicht im Moment. Wenn es überhaupt noch Fiction gibt, ist die Frage überall: Kriegen wir das nicht auch ein bisschen leichter?
Die Sender wollen keine düsteren Serien.
Ja, aber was ist „düster“? Was ist „hell“? Ich finde KDD überhaupt nicht düster.
Nicht?
Nein. Eigentlich, um es ganz pathetisch zu formulieren, obsiegen doch am Ende immer die positiven Werte. Es gibt eine Loyalität in dieser Gruppe von Polizisten, sie werden aufgefangen, alle miteinander, wem auch immer es schlecht geht. Es gibt Figuren wie Stieglitz, die sich in eine Sache reinwühlen, um sie aufzuklären, das ist für mich hell. Aber natürlich sieht das düster aus. Aber was mit den Kriterien „düster“ und „hell“ gemeint ist, ist vermutlich Eskapismus: Hilft es mir, mich wegzuträumen, oder hilft es mir nicht?
In dem Sinne ist KDD beides: fantastisch und realistisch.
Wenn die Dinge im Fernsehen fiktional authentischer erzählt werden, heißt es: Können wir nicht mehr in Richtung Märchen gehen, mit einer schönen moralischen Auflösung? Gleichzeitig gibt es ein unglaubliches Bedürfnis nach Authentizität — im nicht-fiktionalen Bereich, mit Schuldnersendungen zum Beispiel, auch ohne Happy End. Ich habe mal eine leichte, durchaus auch eskapistische Serie über einen Insolvenanzwalt vorgeschlagen. Die Antwort war: Das ist zu düster. Da geht es um Schulden, existenzielle Krisen, Arbeitslosigkeit… Dabei funktioniert das im Doku-Bereich hervorragend.
Es gibt wenige deutsche Serien, in die das Leben schwappt.
In Serien nicht, aber in Einzelstücken, den Tatort. Aber was wirklich fehlt und mich auch als Zuschauer interessiert: Ein moralisches Dilemma hinzustellen und es nicht zu lösen. Weil, woher soll ich die Lösung wissen? Ich sehe bei den Serien auch kein Licht am Horizont. Ich würde gerne eine BND-Geschichte machen, erzählt durch eine Paartherapie von einem Ehepaar, das zusammen arbeitet und Spionagegeschichten zum Therapeuten bringt. Das hab ich gar nicht erst versucht. Sobald Sie das jemandem erzählen, wird der Ihren Puls fühlen. Das ist zu komplex.

Foto: ZDF
Haben Sie mit der Resonanz auf KDD gerechnet?
Ich hab wirklich eineinhalb bis zwei Jahre nichts anderes gemacht als das. Das war quasi mein Leben. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir alle etwas Großartiges machen: Lauter verrückte Menschen, die da zusammen gearbeitet haben. Mit Kathrin Breininger der Glücksfall einer mutigen, klugen Produzentin. Dann Nessie Nessauer, die das Casting gemacht hat, was sie sonst für Serien nie macht. Saskia Vester als lesbische Polizistin zu besetzen — was ist das denn für eine Idee! Ich hatte das Gefühl, ich schreibe etwas Großartiges — und das habe ich selten. Ich habe nicht gedacht, ich mache das perfekt, aber es ist etwas Neues. Und dann kam immer eine Schicht dazu: die unglaubliche Ausstattung, eine tolle Kamera, dieses großartige Ensemble. Und wir haben so gearbeitet, wie andere nicht arbeiten. Mit ausführlichen Leseproben vor jedem Block. Jetzt sprechen wir sogar vor der Staffelentwicklung mit den Schauspielern, das ist ein großer Luxus und macht ungeheuren Spaß. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl: Das wär‘ jetzt aber blöd, wenn das nicht ankommt. Mit dieser positiven Resonanz habe ich aber trotzdem nicht gerechnet.
Meinen Sie, dass so was eine Wirkung hat und andere ermuntert, ähnliches zu probieren?
Dafür hätte es schon der überragende Quotenerfolg sein müssen. Es ist ja nicht so, dass die Sender denken: Das ist qualitativ toll, das wollen wir auch, weil wir auch Preise wollen. Es gab die letzten zwei Jahren, glaube ich, keine einzige erfolgreiche Serie außer dem Bergdoktor.
KDD – Kriminaldauerdienst, freitags, 21.15 Uhr, ZDF.
Das Gespräch ist die Langfassung eines Interviews, das in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ erschienen ist.
Stefan, 30. April 2008, 13:48.