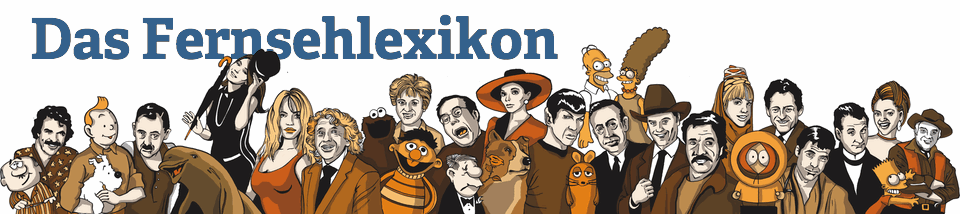Der große Preis
1974–1993 (ZDF). „Ein heiteres Spiel für gescheite Leute“. Wissensquiz mit Wim Thoelke, das zu einem der größten Erfolge im deutschen Fernsehen und einem Dauerbrenner wurde.
Drei Kandidaten müssen in drei Spielrunden ihr Allgemein- und Fachwissen unter Beweis stellen. In der ersten Runde spielt jeder Kandidat allein und beantwortet Fragen zu einem selbstgewählten Fachgebiet, mit dem er sich bei der Sendung beworben hat. Eine Frage bestimmt er vorab als so genannte Masterfrage, für deren Beantwortung ein erhöhter Geldbetrag ausbezahlt wird.
Ab der zweiten Runde sitzen die Kandidaten bis zum Ende der Sendung in futuristisch anmutenden Kapseln, die von einer Schweizer Hubschrauberfirma hergestellt wurden. Sie spielen nun gegeneinander und beantworten Fragen zum Allgemeinwissen. Diese verbergen sich hinter Feldern mit Buchstaben oder Zahlen an einer Ratewand, die schon 1974 „Multivisionswand“ genannt wurde. Meistens gibt es zu den Fragen eine kurze filmische oder akustische Zuspielung. Wer eine Frage richtig beantwortet hat, wählt das nächste Feld an der Wand. Antworten darf, wer sich dann per Knopfdruck schneller zu Wort meldet. Außerdem verbergen sich hinter der Wand noch „Glücksfragen“, die 500 DM wert sind, und Joker, für die es ohne Gegenleistung 100 DM gibt. Wer ein Feld wählt, hinter dem sich eine „Risiko“-Frage verbirgt, darf diese auf jeden Fall beantworten – die anderen Kandidaten können sich nicht melden. Bei diesen Fragen bestimmt der Kandidat die Gewinnsumme selbst, indem er von seinem bisher erspielten Geld einen Teil oder alles setzt.
In der Finalrunde spielt wieder jeder Kandidat allein in seinem Fachgebiet – nun mit Kopfhörer in der geschlossenen Kapsel, damit niemand vorsagen kann. Nur wer die dreiteilige Frage komplett beantwortet, verdoppelt seinen Gewinn, andernfalls verliert er alles bis auf die erspielte Summe aus der ersten Runde. Der Champion ist beim nächsten Mal wieder dabei.
Die Aufteilung auf der Multivisionswand veränderte sich im Lauf der Jahre. Lange Zeit gab es sechs Themenspalten mit Feldern von 20 bis 100 DM und entsprechendem Schwierigkeitsgrad. Vorübergehend war eine Spalte als „Aktuell“-Spalte mit Buchstaben statt mit Geldbeträgen beschriftet. Später verbargen sich die Fragen hinter Buchstaben, das Thema war vorher nicht zu erkennen, und jede Antwort war 100 DM wert. Dauerhaft war das Feld mit dem Fragezeichen auf der Wand. Es durfte erst als letztes gewählt werden, weil sich ihm ein Show-Act anschloss, der die zweite Runde beendete.
Für jedes Fachgebiet war während der gesamten Sendung ein Experte anwesend, der im Zweifelsfall vor allem in der dritten Runde entschied, ob die gegebene Antwort richtig oder falsch war. Die Regeln waren streng, nie wurde bei einer falschen Antwort ein Auge zugedrückt. Die zuerst gegebene Antwort war verbindlich; selbst wenn sich der Kandidat sofort danach korrigierte, galt das nicht mehr. Über den korrekten Ablauf wachte außer den Experten und nicht weniger als vier Assistentinnen ständig ein Notar als „Oberschiedsrichter“, bis 1984 Eberhard Gläser, danach Nils Clemm. Einmal antwortete ein Kandidat auf eine Frage: „Da muss ich raten, Goethe oder Schiller. Ich sag‘ mal Schiller.“ Thoelke: „Das tut mir leid, Goethe wäre richtig gewesen …“ Oberschiedsrichter Klemm: „Das tut mir gar nicht leid. Die zuerst gegebene Antwort gilt, und die war Goethe …“
Der Große Preis war die Sendung zur ZDF-Fernsehlotterie Aktion Sorgenkind. Wenn Kandidaten am Ende ihr Geld verloren, floss es ihr zu. Die Ziehung der Gewinnzahl für die Lose der Fernsehlotterie wurde immer einige Tage vorher aufgezeichnet und in der Sendung eingespielt. Während der Sendung wurden aus einer Lostrommel die Gewinner der höchsten Preise gezogen und verlesen, meist mit Unterstützung eines prominenten Gasts. Thoelkes Assistentin Beate Hopf verlas mehrfach während der Sendung neu gezogene Gewinner. Ihre Nachfolgerin wurde nach 14 Jahren die deutlich frechere Karoline Reinhardt. Als Glücksbringer trat in den ersten Jahren Walter Spahrbier in immer anderen historischen Postuniformen auf, der diese Rolle bereits in den Sendungen von Peter Frankenfeld und bei Drei mal neun übernommen hatte.
Zum beliebtesten Element der Sendung wurde der Dialog Wim Thoelkes mit den Zeichentrickfiguren Wum und Wendelin. Thoelke stand vor einer Blue Box und führte hölzern einen Dialog mit dem Hund Wum, der bereits in Thoelkes Sendung Drei mal neun mit von der Partie war, und dem Elefanten Wendelin. Sie stammten beide aus der Feder von Loriot, der ihnen auch die Stimme lieh. Ab 1983 sprach Jörg Knör auf Loriots Bitte die Figuren, zu denen sich manchmal auch der – ebenfalls gezeichnete – blaue Klaus mit seiner Untertasse gesellte. Es ging um alles Mögliche, aber am Ende des Gesprächs immer um den Einzahlungstermin für die Aktion Sorgenkind. Der Abschlusssatz „Stichtag: Samstag in acht Tagen“ wurde zum geflügelten Wort. Wum und Wendelin als Maskottchen des Großen Preises und der Fernsehlotterie leiteten auch den Beginn jeder Sendung ein und kündigten den Moderator mit einem von Wum gebrüllten „Thoooooooeeeeeeelke!“ an.
Im Showblock bot Thoelke vor allem jungen, unbekannten Künstlern ein Forum, die oft mit klassischer Musik auftraten. Dauergast war der Kabarettist Wolfgang Gruner, der als Berliner Taxifahrer Fritze Flink aktuelle Ereignisse kommentierte, an die sich eine Frage für die Kandidaten anschloss.
Die ersten Alterserscheinungen tauchten bereits nach weniger als sechs Jahren auf: Die Wand fiel aus. Der Vorfall war im Fernsehen aber nicht zu sehen, weil die Sendung aufgezeichnet wurde. Erst ab der 150. Ausgabe am 12. Februar 1987 war Der Große Preis eine Live-Sendung. Über 18 Jahre lang moderierte Wim Thoelke das Quiz. Er war kompetent, souverän, akribisch vorbereitet (die Fachfragen in der ersten Runde stellte er auswendig) und humorfrei. Er wurde oft als langweilig gescholten, war aber dennoch einer der großen Sympathieträger des deutschen Fernsehens. Nur im April 1991 war er einmal krank und musste sich von Wolfgang Lippert vertreten lassen.
Sendeplatz der 80 Minuten langen Quizshow war fast immer donnerstags um 19.30 Uhr, erst in den letzten Jahren rückte sie auf 20.00 Uhr.
Am 10. Dezember 1992 moderierte Wim Thoelke den Großen Preis zum 220. und letzten Mal. Mit angeblich rückläufigen Zuschauerzahlen habe diese Entscheidung nichts zu tun, ließ Thoelke kurz zuvor in den „Stuttgarter Nachrichten“ wissen, während die „Süddeutsche Zeitung“ ihn eine Woche später mit den Worten zitierte, das Fernsehen, wie es heute ist, sei nicht mehr sein Fall. Hinterher rechnete er in einem Buch wüst mit dem ZDF ab und warf u. a. namentlich nicht genannten Redakteuren Korruption vor.
Das ZDF verpflichtete den sechs Jahre älteren Hans-Joachim Kulenkampff als neuen Moderator und verlegte die Sendung auf den großen Samstagabendtermin um 20.15 Uhr, was vielversprechend begann: Kuli nahm in seiner Premiere sich selbst wegen seines Alters und des neuen Sendeplatzes auf den Arm, humpelte am Stock auf die Bühne und faselte: „Wo ist Wetten, dass …?„. Dennoch moderierte er nur sechs Sendungen, sanken doch im Lauf dieses halben Jahres die Einschaltquoten rapide. Vom ursprünglichen Quizcharakter war durch Kulis lange Monologe viel verloren gegangen. So übernahm im Sommer 1993 Carolin Reiber. Allerdings konnte auch sie die Show nicht mehr retten, die nach nur weiteren sechs Sendungen endgültig eingestellt wurde. Missglückter Nachfolger wurde die Goldmillion. Acht Jahre später beschloss das ZDF nach einer Reihe von Flops am Donnerstagabend, dass diese Absetzung doch nicht so endgültig war, und legte Der Große Preis neu auf.
Das Format beruhte auf dem italienischen „Riscia Tutto“ und dem Schweizer „Wer gwünnt“, hatte aber auch Ähnlichkeiten mit dem US-Format „Jeopardy!“, das seit 1964 auf Sendung war und Deutschland erst mit einigen Jahrzehnten Verspätung erreichte.
Der heiße Brei
2006 (Sat.1). Comedyshow am späten Freitagabend mit Jochen Busse und Parodisten, die aktuelle Polittalkshows persiflieren wollten. Floppte vorher schon als Talk im Tudio mit Lou Richter und überlebte auch mit neuem Titel und besserem Moderator nicht einmal einen Monat.
Der Heimat so fern
„Wir präsentieren unseren Zuschauern die derzeit beste Serie der Welt“ sagte Sat.1-Chef Nicolas Paalzow und gab Homeland den Sendeplatz, den die beste Serie der Welt in seinen Augen offenbar verdient: am Abend vor einem Werktag nach 23 Uhr. Nur zum Start läuft Homeland schon um 22.15 Uhr und mit zwei Folgen am Stück. Der regelmäßige Sendeplatz der Serie ist aber vermutlich eine vorbeugende Maßnahme: Dort wäre sie ohnehin nach ein paar Wochen gelandet.
Denn Homeland ist genau die Art von Serie, die im deutschen Fernsehen nicht funktioniert: Spannend, toll erzählt, gut besetzt, anspruchsvoll und mit hohem Suchtfaktor. Außerdem sehr amerikanisch. Leider wird am Anfang einer Episode aber eben niemand ermordet und am Ende deshalb auch kein Täter überführt. Die Handlung zieht sich über eine ganze Staffel. Es geht um Terrorismus und im Konkreten um die Frage: Ist ein heimgekehrter Kriegsheld in Wirklichkeit ein Terrorist? Claire Danes, bekannt aus der Teenie-Serie Willkommen im Leben, spielt die CIA-Agentin mit bipolarer Störung, die das Doppelspiel zu beweisen versucht. Damian Lewis mimt den terrorverdächtigen uramerikanischen Kriegsveteranen, der nach acht Jahren in Gefangenschaft seine eigene Familie neu kennenlernen muss und einige Geheimnisse für sich behält. Lewis selbst ist übrigens Brite. Er hatte zuvor im Vox-Krimi Life die Hauptrolle gespielt. Beide brauchen seit dem Start der Serie neue Schränke, um die vielen Preise überhaupt noch irgendwo hinstellen zu können.
In den USA startet in diesem Jahr bereits die dritte Staffel. Wie lange sich die Geschichte einigermaßen glaubwürdig ziehen lässt, wird sich dann allmählich zeigen. Soweit sind wir hierzulande natürlich noch lange nicht, und damit kann sich dann ja vermutlich Kabel 1 in drei Jahren rumschlagen. Schon in der zweiten Staffel findet der besessene Fan nämlich den einen oder anderen kleinen Nervfaktor – aber so ist es nun einmal, wenn man sich intensiv auf eine Serie einlässt und viel Zeit investiert. Je mehr eine Serie den Zuschauer in ihren Bann zieht, desto mehr achtet dieser auch auf Details und Nebensächlichkeiten. Und diese Serie hat es verdient, dass man sich intensiv auf sie einlässt und Zeit investiert. Zum Beispiel auf DVD mit selbstgewählter Eventprogrammierung. Das deutsche Fernsehen hat diese grandiose Serie jedenfalls nicht verdient.
Der Heinz-Sielmann-Report
1993–1994 (Sat.1). Umweltmagazin mit Heinz Sielmann, Koproduktion mit dem World-Wildlife-Fund.
Der Naturfilmer zeigt, wie schön die Natur und die Tierwelt sind, wie sehr wir sie schon zerstört haben und was wir dafür tun können, um zu retten, was noch zu retten ist. Obwohl Sielmann inzwischen ziemlich durch die Sender tingelte (zuvor machte er bei RTL Sielmann 2000), waren seine Filme immer noch eindrucksvoll und aufrüttelnd.
Das Magazin lief dienstags in der Primetime.
Der Hit zur Strandzeitlupe
Ich suche ein bestimmtes Lied, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Und zwar die Titelmelodie von der US-Serie Baywatch, sprich die Melodie, die im Vorspann immer lief wenn Hasselhoff und Co. vorgestellt wurden. Habe bei amazon.de geschaut, da gibts ne CD. Die CD wird aber aus den USA geliefert und da fallen zusätzliche Zollgebühren an. Ist mir zu teuer und zu heikel. Weißt du eine Möglichkeit wie man an das Lied rankommt??? Es heißt, glaube ich, „I’m always here“ oder „I believe“ (der Sänger singt immer was von „I’ll be ready…..I’ll be there“). Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Das wäre toll. — Nina
Der Song heißt tatsächlich „I’m Always Here“ und wurde von Jim Jamison gesungen. Es war schon der zweite Titelsong von Baywatch, nachdem in der ersten Staffel „Save Me“ von Peter Cetera verwendet worden war.
Jim Jamison war Mitte der 80er-Jahre der Sänger der Band Survivor (noch nicht bei deren Hit „Eye Of The Tiger“, aber bei „Burning Heart“) und versuchte 1999 noch einmal, daraus und aus Baywatch Profit zu schlagen, indem er den Song als „Jimi Jamison’s SURVIVOR“ noch einmal als Single und auf seinem Album veröffentlichte. Diese Version unterscheidet sich marginal von der in der Serie verwendeten, ist aber zumindest günstiger heute noch erhältlich.
Die Original-Serienversion wurde nie als Single veröffentlicht, sondern erschien nur auf dem von Dir genannten Album.
Vor gut einem Jahr erschien außerdem eine neue Danceversion des Titels unter dem Interpretennamen Sunblock und dem Titel „I’ll Be Ready“, die in Top-10-Hit in England wurde.
Der Illegale
1972 (ZDF). „Biographie eines Spions“. 3‑tlg. dt. Spionagethriller von Henry Kolarz, Regie: Günter Gräwert.
Nikolai Grunwaldt (Götz George) heuert 1952 beim sowjetischen Geheimdienst an. Mit Freundin Katharina Feldmann (Vera Tschechowa) pachtet er zur Tarnung eine Wurstbude und spioniert im Auftrag von General Alexander Korotkow (Gustav Knuth) die Deutschen aus. Das kapitalistische Leben gefällt Grunwaldt jedoch, und so läuft er schließlich über.
Lief in Spielfilmlänge im Abendprogramm.
Der internationale Frühschoppen
1953–1987 (ARD). Wöchentliche politische Diskussion mit sechs Journalisten aus fünf Ländern unter der Leitung von Werner Höfer.
Jeden Sonntag gegen Mittag versammelten sich um Höfer herum weitere Journalisten, die wöchentlich wechselten, und redeten über aktuelle Weltpolitik. Zu den deutschen Stammgästen gehörten u. a. Rudolf Augstein, Henri Nannen, Marion Gräfin Dönhoff, Günter Gaus, Peter Scholl-Latour, Julia Dingwort-Nusseck und Theo Sommer. Höfer selbst jedoch sprach von allen Anwesenden die meiste Zeit, durchschnittlich 18 von 45 Minuten. Er war der Diskussionsleiter, der die Runde im Griff hatte und bei Bedarf zur Ordnung rief, blieb aber nicht neutral, sondern diskutierte mit, sagte seine Meinung und wurde ab und zu ungehalten, wenn jemand partout anderer Meinung war. Schon 1959 nannte der „Spiegel“ den Frühschoppen die „Werner-Höfer-Schau“.
Er war jedoch nicht immer eine biedere Sendung zur Selbstdarstellung des Moderators, sondern sprach auch heikle Themen an: 1962 thematisierte Höfer die „Spiegel-Affäre“ im Sinne des zu Unrecht verfolgten Nachrichtenmagazins; 1968 setzte er gegen massiven Druck aus der Politik durch, dass „Stern“-Chefredakteur Henri Nannen auftreten durfte, der gerade Bundespräsident Lübke „kleinkariert“ und eine „bedauernswerte Figur“ genannt hatte. Allerdings soll Höfer ein Zeichen ausgemacht haben, auf das hin die Sendung abgebrochen würde, falls Nannen nachlegen sollte. Nannen legte nach, wurde von Höfer zurechtgewiesen, doch die Sendung ging weiter.
Die Reihe war bereits 1952 im Radio gestartet und wurde während der Funkausstellung 1953 in Düsseldorf zum ersten Mal schlicht abgefilmt. Nach diesem Procedere lief die Sendung weiterhin zeitgleich im Hörfunk und im Fernsehen. Zuhörer verpassten nichts, da man auch im Fernsehen lediglich ein paar Leute um einen Tisch herumsitzen und Wein trinken sah. Eine Bedienung schenkte regelmäßig nach. Manchmal sah man sie auch nicht, weil sie hinter den Rauchschwaden der Zigarillos verschwunden waren. Mag sein, dass der Wein die hitzigen Diskussionen noch weiter angeheizt hat. Genau das war Höfers Ziel, der weniger die Atmosphäre einer trockenen Redaktionssitzung, sondern die eines Stammtischs haben wollte. Das wurde selbst in seinen Ordnungsrufen deutlich: „Hier geht es zu wie in einer polnischen Kneipe, wo schwarz gebrannter Wodka gereicht wird. Aber hier ist ein Weinlokal.“ Bei dem Wein handelte es sich um „Maikämmerer Heiligenberg“, eine Riesling-Spätlese aus der WDR-Kantine. Wer keinen Wein wollte, bekam Apfelsaft. Das war jedoch eine Seltenheit.
Ursprünglicher Titel war bis Ende 1953 Der internationale Journalisten-Frühschoppen. Anfangs wurde von den Düsseldorfer Rheinterrassen, später aus dem Studio des WDR gesendet, manchmal auch von irgendwo: Für die Live-Sendung war ein Übertragungswagen der Technik nötig, der WDR hatte aber damals nur einen, und der war oft bereits für Sportübertragungen am Nachmittag gebucht und hätte nicht rechtzeitig umgebaut werden können. Also veranstaltete Höfer seinen Frühschoppen dann einfach in irgendeinem Raum in unmittelbarer Nähe der Sportstätte, wodurch die Übertragung beider Veranstaltungen möglich wurde.
Im Lauf von dreieinhalb Jahrzehnten gab es nur wenige Veränderungen. Die Zahl der Journalisten und Länder änderte sich manchmal, wenn jemand fehlte. Hatte ein Journalist kurzfristig oder gar nicht abgesagt, fiel er umso mehr in der Sendung auf, weil dort dann ein leerer Stuhl stand und ein herrenloses Namenschild auf dem Tisch. Einmal fehlte Höfer selbst. Wegen einer Sturmflut saß er auf Sylt fest, wo er Urlaub gemacht hatte. Er war seinem Frühschoppen an diesem Tag nur telefonisch zugeschaltet. Der Tisch, an dem die Runde tagte, war anfangs ein gewöhnlicher Wohnzimmertisch, später ein nierenförmiger. Eines Tages geschah das Unfassbare: Frauen diskutierten mit. Höfer nahm sie bei der Hand, erklärte ihnen, wie sie sich gegen die „rüde europäische Horde“ durchsetzen müssten, änderte aber nichts an seiner Standardanrede „Meine Herren“ und wandte sich unter Umständen danach noch direkt an die anwesende Dame: „Sie spielen im Moment gar keine Rolle.“ Dann beschränkte Höfer seine Runde doch wieder auf Männer („Es geht schließlich um Politik“).
Der Frühschoppen genoss lange Zeit eine Monopolstellung im politischen Meinungsbildungsprozess, war Pflichtprogramm am frühen Sonntagmittag. Bis 1970 begann er um 11.30 Uhr. Seine Verlegung auf 12.00 Uhr löste Zuschauerproteste vor allem von Frauen aus, die sich beklagten, die Sendung nun nicht mehr sehen zu können, da sie zu dieser Zeit kochen und den Tisch decken müssten. Zur 1000. Sendung kam ein Politiker ins Studio: Bundeskanzler Willy Brandt gratulierte persönlich. 1967 erhielt Höfer einen Adolf-Grimme-Preis mit Silber. Die Jury begründete die Auszeichnung damit, dass die „Spontaneität der Beiträge der Gesprächsteilnehmer“ den Zuschauer „zu aufmerksamem und konzentriertem Mitdenken“ zwinge.
Die erfolgreiche Reihe brachte es auf 1874 Sendungen. Am Morgen des ersten Weihnachtstags 1953 moderierte Höfer außerdem den „Internationalen Kindergarten“ (kein Witz) und an Neujahr 1954 den „Internationalen Politiker-Frühschoppen“. Die berühmte Anfangsansage „… mit sechs Journalisten aus fünf Ländern“ machte Egon Hoegen. 1987 fand die Sendung ein plötzliches Ende. Der „Spiegel“ enthüllte, dass der junge Höfer 1943 im Zweiten Weltkrieg in einem Artikel die Hinrichtung des Pianisten Karlrobert Kreiten wegen Wehrkraftzersetzung positiv kommentiert hatte. Der WDR trennte sich daraufhin sofort von seinem Star-Journalisten und stellte die Reihe ein. Auf dem Sendeplatz startete nur eine Woche später eine fast identische Sendung unter dem Namen Presseclub.
Im Oktober 2002 begann im öffentlich-rechtlichen Ereignis- und Dokumentationskanal Phoenix eine Neuauflage unter dem Originaltitel, die seither immer dann ausgestrahlt wird, wenn der Presseclub im Ersten wegen Sportübertragungen ausfallen muss.
Der Job
2003 (ARD). 19-tlg. US-Comedyserie von Peter Tolan und Denis Leary („The Job“; 2001–2002).
Der New Yorker Polizist Mike McNeil (Denis Leary) ist alles andere als ein Vorbild. Er raucht, nimmt Medikamente und hat neben seiner Ehefrau Karen (Wendy McKenna) noch eine Geliebte namens Toni (Karyn Parsons). Sein Job ist für ihn eben ein Job, dennoch setzt er viel daran, ihn effektiv auszuüben. Dafür übertritt er dann auch mal Grenzen. Der grundsolide Terrence „Pip“ Phillips (Bill Nunn) ist sein Partner, Kollegen auf dem Revier sind der alte Frank Harrigan (Lenny Clarke) und dessen junger Partner Tommy Manetti (Adam Ferrara), außerdem Jan Fendrich (Diane Farr), die einzige Frau im Revier, die Neulinge Ruben Sommariba (John Ortiz) und Al Rodriguez (Julian Acosta) und der Vorgesetzte Lt. Williams (Keith David).
Witzige und ehrliche Comedy, in der Polizisten bei einer Verfolgungsjagd auch mal außer Atem gerieten – in welcher Polizeiserie sah man das sonst?
Lief dienstags um Mitternacht. Nach viel zur kurzer Zeit wurde die Serie abgesetzt. Serienerfinder und Hauptdarsteller Denis Leary griff das Konzept leicht abgewandelt später noch einmal auf. 2004 startete in den USA „Rescue Me“, eine Serie über einen New Yorker Feuerwehrmann.
Der König
1994–1996 (Sat.1). 30-tlg. dt. Krimiserie von Michael Baier.
Der pensionierte Kommissar Hannes König (Günter Strack) wird immer wieder von seinem jungen Nachfolger Axel Hübner (Michael Roll) um Hilfe bei schwierigen Fällen gebeten. Seine ehemalige Sekretärin Ingrid Dorn (Renate Schroeter) mag ihren alten Chef noch immer lieber als den neuen und schleust Informationen an Hübner vorbei direkt an König, der die Fälle dank dieser Hilfe und dank der des Gerichtsmediziners Dr. Eugen Pröttel (Wilfried Klaus) und dessen Assistentin Gisela Hellwig (Petra Berndt) aufklärt. Der Zeitungsreporter Horst Gierke (Dieter Brandecker) ist immer auf der Suche nach einer Story und König deshalb oft auf den Fersen. Seine noch übrige Freizeit verbringt der Rentner König in seinen eigenen Weinbergen oder im Weinlokal „Traube“, wo Karl Schober (Walter Renneisen) der Wirt ist. König ist stets mit dem Bus unterwegs und kennt den Busfahrer Pichler (Volker Prechtel) daher gut.
Die Serie, für die Sat.1 Günter Strack teuer vom ZDF weggekauft hatte, kam beim Publikum gut an, aber leider nicht beim jungen Publikum, an dem die Werbeindustrie interessiert war. Da sie damit für das Sat.1-Programm typisch war, mussten erst die Verantwortlichen gehen und dann die Serien – es sei denn, sie ließen sich verjüngen, was etwa bei Der Bergdoktor, Wolffs Revier und Kommissar Rex versucht wurde.
Die einstündigen Folgen liefen dienstags, ab 1996 mittwochs um 20.15 Uhr. Nach dem Ende der Serie waren ab September 1997 in loser Folge drei übrig gebliebene Der König-Fernsehfilme zu sehen.
Der König der Leos
Kennen Sie Eddie Leo Schruff? Nein? Dann geht es Ihnen so wie vermutlich 80 Millionen anderen Deutschen. Schruff war Sieger der ZDF Castingshow „Die Deutsche Stimme 2003“, und er lässt sich heute noch in Wikipedia finden. Der Eintrag trägt aber nicht den Namen Schruff, sondern „De Wanderer“, das ist eine eine Kölner a-capella-Gruppe, in der Schruff seit der ZDF-Show singt. Klickt man weiter unten auf den Link „Deutsche Stimme“, um etwas mehr über diese Show zu erfahren, findet man den Eintrag zum Parteiorgan der rechtsextremen NPD, das auch „Deutschen Stimme“ heißt. Soweit, so tragisch.
Warum wir das an dieser Stelle erzählen? Weil das ZDF seit heute Abend den Musical-Showstar 2008 castet, und diesmal zwei Sänger finden wird, die man außerhalb der Musicalszene noch schneller vergessen wird als Eddie Leo Schruff.

Thomas Gottschalk moderiert, pardon, ist kurz im Vorspann zu sehen, ansonsten spricht er lediglich den Off-Kommentar. Am Schluss taucht er dann doch noch mal auf, um während eines Spaziergangs im Central Park auf die nächste Sendung hinzuweisen. Nächste Woche ist er dann wieder aus New York zurück, dann muss er ja die Liveshows moderieren. Bis dahin ist der Star der Sendung ein Mann mit Glatze, der im ersten Moment unangenehm an Heinz Henn erinnert, den kölschen Dauerfeind von Dieter Bohlen aus den vergangenen DSDS-Staffeln. Diese Glatze gehört aber Jury-Mitglied Alexander Goebel, Max-Reinhardt-Seminarist und Burgtheaterschauspieler und eben auch Musicaldarsteller. Der Mann weiß, wovon er spricht; er ist freundlich, sympathisch, intelligent, und besitzt damit keine der Eigenschaften, die Jurymitglieder anderer Castingshows auszeichnen. Katja Ebstein (Schlager) und Uwe Kröger (Musical) fallen kaum auf, das hier ist die Goebel-Show.

Der Rest der Sendung funktoniert wie alle anderen Castingshows auch: Kandidaten werden in kurzen Einspielern vorgestellt, entweder weil sie besonders gut oder besonders skurill sind, so wie Alexander (28), der mit seiner Mutti zum Casting kommt. Wie schon vorab von den Verantwortlichen angekündigt, werden keine Totalausfälle vorgeführt. Um das zu unterstreichen, reagiert Goebel auf einen Kandidaten mit Texthänger so: „Du würdest Dich erbärmlich blamieren, und das wollen wir Dir ersparen.“ Damit schießt sich die Produktion argumentativ leider selbst ins Bein, denn der Kandidat hat sich soeben blamiert. Im Fernsehen.
 Abgesehen von ein paar Ausrutschern, und auch mal angesehen davon, dass Castingshows eben aus Jury, Vorsingen und kurzen Vorstellungen der Kandidaten bestehen, ist diese Sendung aber tatsächlich anders. Sie ist freundlich. Und das liegt am Genre, denn hier wird ja ein Musicalstar gesucht und kein Teenie, der über Wochen zum Superstar hochgejazzt wird. Hier gibt es keine talentfreien Jugendlichen, die auch noch unverschämt werden, wenn man sie rausschmeißt und dann von Dieter Bohlen (zu Recht) beschimpft werden. Und falls sich solche Rotznasen doch getraut haben, werden wir sie nie sehen, denn im Fernsehen wird ja erst der Recall gezeigt.
Abgesehen von ein paar Ausrutschern, und auch mal angesehen davon, dass Castingshows eben aus Jury, Vorsingen und kurzen Vorstellungen der Kandidaten bestehen, ist diese Sendung aber tatsächlich anders. Sie ist freundlich. Und das liegt am Genre, denn hier wird ja ein Musicalstar gesucht und kein Teenie, der über Wochen zum Superstar hochgejazzt wird. Hier gibt es keine talentfreien Jugendlichen, die auch noch unverschämt werden, wenn man sie rausschmeißt und dann von Dieter Bohlen (zu Recht) beschimpft werden. Und falls sich solche Rotznasen doch getraut haben, werden wir sie nie sehen, denn im Fernsehen wird ja erst der Recall gezeigt.
Soviel zum Vorteil des Genres Musical, jetzt zu den Nachteilen: Kann mir mal jemand erklären, warum Musical-Texte so erbärmlich sein müssen? Gibt es keine guten Übersetzer? Sind die Originale schon so dämlich geschrieben? Und dann ist da noch die Sache mit dem „Star“:
„Wir suchen einen Musical-Darsteller, der ein absoluter Star wird“, sagt Uwe Kröger, und bei der Gelegenheit musste ich eben mal nachschauen, wer Uwe Kröger ist. Musicalstars sind wahrscheinlich nur der Gemeinde der Musicalfans bekannt. Somit wird der Ruhm der Kandidaten jetzt von der Quote der Fernsehsendung abhängen, denn nur so lange die Show läuft, werden sie wenigstens ein bisschen so etwas wie ein Star sein.
Musical-Showstar 2008, die nächsten Folgen laufen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, jeweils um 19.25 Uhr, die Liveshows mit Thomas Gottschalk ab nächste Woche immer Mittwochs um 20.15 Uhr.