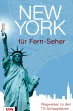Hannes Jaenicke und ich schauen die gleichen Serien. Nämlich alle. Naja, fast. Wir teilen die Vorliebe für die Münsteraner Tatort-Kommissare und eine Abneigung gegen David Carusos Gehabe in CSI: Miami, mögen aber die CSI-Varianten aus Las Vegas und New York. Als ich die vielen Gemeinsamkeiten bemerkte, fragte ich irgendwann nur noch sein Sehverhalten für Einzelsendungen ab.
Im Grunde ging es um die Unterschiede zwischen deutschem und amerikanischem Fernsehen, und warum US-Serien derzeit so erfolgreich sind. Jaenicke kennt beide Seiten. Er ist einer der wenigen deutschen Schauspieler, die in Hollywood mehr als einen Fuß in der Tür haben und wirkte neben vielen deutschen auch in zahlreichen amerikanischen Produktionen mit. Weil er die Hälfte des Jahres in Los Angeles lebt, ist er auch als Zuschauer beiden Modellen gleichermaßen ausgesetzt.
Hannes Jaenicke ist der Star der neuen RTL-Serie Post Mortem (ab 18. Januar donnerstags um 20.15 Uhr), die sehr amerikanisch daherkommt.
Mögen Sie das amerikanische Fernsehen?
Ich habe sehr viel amerikanisches Fernsehen gemacht und denke, das sehen wir ja an den Quoten, dass die völlig einsam in der Qualität ihrer Fernsehproduktionen sind. Das ist im Moment nicht zu schaffen, was die machen. Schon seit Jahren. Das fängt bei den Sopranos an, sogar schon bei den Straßen von San Francisco und Columbo. Die Amerikaner machen seit fünfzig Jahren das führende Fernsehen. Das ist die Latte, an der wir uns messen müssen.
Vor allem die Krimis sind im Moment sehr erfolgreich.
Aber es laufen ja auch die Comedys. Schauen Sie sich Desperate Housewives an, Sex And The City, Will & Grace. Die haben eine Fernsehkultur, die wir vielleicht irgendwann, und das wird lange nach meinem Ableben stattfinden, vielleicht mal hinbekommen. Ich werde das nicht mehr erleben.
Aber Sie versuchen es ja gerade mit Post Mortem und lehnen sich dabei stark an CSI an.
Natürlich können wir das Format Rechtsmedizin nicht neu erfinden. Was Thomas Jauch, der Regisseur, und ich uns in den Kopf gesetzt haben, war: Wenn wir das machen, muss es anders aussehen als andere deutsche Fernsehprodukte. Und wir sind natürlich große 24-Fans, und Sie werden schnell feststellen, dass wir das sehr ähnlich aufgelöst haben vom Schnitttempo her. Wir wollten es stilistisch anders machen, als es hierzulande bislang gemacht wird. Wenn das geglückt ist, dann sind wir schon mal froh.
Man sieht zumindest deutlich, dass diejenigen, die dahinter stecken, sich mit dem amerikanischen Fernsehen befasst haben. Viele Produzenten versuchen sich an einem Abklatsch, ohne sich ernsthaft mit den Originalen auseinanderzusetzen.
Thomas Jauch und ich sind bekennende Fans von Michael Mann und Scorsese und anderen amerikanischen Serien. Wir gucken Die Sopranos, und wir haben uns natürlich sämtliche Folgen von 24 reingezogen. Thomas und ich sind sicher vom amerikanischen Fernsehen stärker beeinflusst als viele andere hierzulande. Das mag man uns jetzt vorwerfen, und das passiert auch regelmäßig, aber das ist nun einmal unser Geschmack. Und Thomas Jauch versteht nicht nur was vom amerikanischen Fernsehen, er hat auch die handwerklichen Fähigkeiten, das tatsächlich selber zu drehen. Ich glaube, wir sind die erste deutsche Fernsehproduktion in der Geschichte, an der zwei US-Studiobosse ans Set gekommen sind, um zu sehen, wie wir das machen.
Wie kam das?
Bei den May-Screenings (der jährlichen Veranstaltung in Los Angeles, bei der die neuen Serien der kommenden TV-Saison erstmals vorgeführt werden), wurde der Pilot gezeigt, und drei, vier Monate später hatten wir plötzlich Michael Lynton am Set und eine Woche später Michael Grindon, die Bosse von Sony/Columbia Tristar. Die wollten einfach mal zusehen. Und die waren, ehrlich gesagt, ziemlich geplättet. Die kennen natürlich deutsches Fernsehen und sind anderes gewohnt, hierzulande, die kennen die sonst übliche deutsche Erzählform, den deutschen visuellen Stil. Und die haben plötzlich gesehen, dass es da ein paar Deutsche gibt, die das so machen wie die Amis.
Das Lustige ist: Der Vorwurf, dass wir CSI nachmachen, kam nie aus Amerika. Die haben sich das angesehen und fanden das großartig. Da hat kein Mensch gesagt: „It’s like CSI„. Oder „It’s like Cold Case„. Sondern nur: „Das ist aber geil. So was haben wir in Deutschland noch nie gesehen.“ Und das ist für uns ganz interessant.
Empfinden Sie es als Vorwurf, wenn ich sage: Das sieht aus wie CSI?
Bei Ihnen nicht. Aber der „Stern“ hat uns gerade fürchterlich in die Pfanne gehauen, die sagen: Ja, aber Vegas ist viel geiler als Köln. Und das ist so typisch deutsch. Wir werden das Format nicht neu erfinden. Auch Ulrich Mühe macht seit Jahren Rechtsmedizin, und auch Jan Josef Liefers macht Rechtsmedizin. Letztendlich machen wir ja alle CSI und Cold Case nach. Aber wir haben eben versucht, es mal stilistisch anders zu machen. Vielleicht ein bisschen flotter, ein bisschen radikaler. Und wenn der „Stern“ dann schreibt, der Caruso mit seiner Sonnenbrille ist cooler als der Jaenicke, dann beleidigt mich das.
Der kann sich ganz toll 45 Minuten lang diese Sonnenbrille immer wieder auf- und absetzen, bis der Fall gelöst ist.
Aber der „Stern“ findet das halt tausendmal cooler als mich. Und dann steht da drin, Miami ist einfach sexier als Köln. Na gut, großes Kunststück. Die haben Palmen und Sandstrände. Daraus einen Strick zu drehen, dass man das hier gleich lassen sollte, ist unglaublich dämlich. Außerdem erzählen wir deutsche Geschichten. Die Geschichten haben mit russischen Einwanderern zu tun, mit dem Verbot von Sterbehilfe, wir erzählen bundesrepublikanische Realität.
Stimmt es, dass Sie immer schon einen Krimi-Kommissar spielen wollten?
Ganz ehrlich: Ich würde gerne einen deutschen Tatort-Kommissar spielen. Den würde ich dann aber auch gern ein bisschen anders gestalten. Wir haben seit Schimanski keinen Kommissar mehr gehabt, der sich mal daneben benimmt. Ich finde, auch der Tatort ist mittlerweile sehr gediegen geworden. Ich hätte gern einen, der mal nicht so konformistisch vorgeht.
Was halten Sie denn von den Münsteranern?
Die finde ich klasse. Die haben gute Autoren, und endlich mal Humor! Das ist unbezahlbar. Und was Prahl und Liefers da spielen ist einfach großartig. Das ist ein Tatort, den sollte man bitte genau so weiterlaufen lassen. Es gibt auch in Köln oder München großartige Tatorte. Trotzdem fände ich ein bisschen frischen Wind in dieser doch mittlerweile inflationären Tatort-Szene nicht so schlecht. Sich da etwas einfallen zu lassen wäre eine spannende Aufgabe.
Wenn Sie sich in Post Mortem in der Gerichtsmedizin über Leichen beugen oder im Labor Tröpfchen in Fläschchen fallen lassen, wissen Sie dann immer, was Sie da gerade tun?
Da wir die komplette Kölner Rechtsmedizin als Beraterstab haben, sind wir da ziemlich gut gebrieft worden. Wir hatten Prof. Markus Rothschild als Chefberater, das ist Deutschlands führender Rechtsmediziner, und der hat einen ganzen Stab von wirklich sensationell hilfsbereiten, klugen, tollen Leuten. Die sind auch erstaunlich witzig, das war eine richtig tolle Truppe. Wenn wir am Sektionstisch standen, stand immer ein Profi dabei. Und wenn wir Begriffe im Text hatten, die wir nicht verstanden haben, wurden sie uns erklärt. Wir haben uns da richtig schlau gemacht. Wenn man dann über diesen Puppen herumhantiert, mit Schweineleber und Schweineherz… Das hat ja bei diesen Leuten eine unglaubliche, sehr kühle, professionelle Selbstverständlichkeit. Professor Rothschild hat oft junge, angehende Fachärzte, die dann mit ganz großer Betroffenheit über einer Selbstmordleiche knien, und dann sagt er: Wer so guckt, fliegt raus. Der will da kein Mitleid, der will auch kein Gefühl. Der will, dass da sachlich gearbeitet wird. Und das kriegt man nur, wenn man mal dabei war, wie die den Darm da rausziehen. Und das Herz. Und das Hirn. Standardgemäß wird ja alles rausgenommen, was der Körper so hergibt. Und ich hab‘ mir das so lange angesehen, bis das für mich auch eine gewisse Selbstverständlichkeit hatte.
Gab es bei den amerikanischen Vorbildern ein spezielles, an dem Sie sich besonders orientieren wollten?
Thomas Jauch und ich haben uns 24 so lange angesehen, bis es uns zu den Ohren rausgekommen ist. Das ist natürlich nicht inhaltlich das Vorbild, aber stilistisch. Wir wollten auch wissen, wie sie das machen, dass die dauernd so schamlos über die Achse gehen. Der Achsensprung wird ja bis heute in Deutschland heiliggesprochen. Rechts, links, links, rechts, und 24 war die erste Serie, die gesagt hat, wisst ihr was, Achsensprung gibt’s für uns nicht mehr. Die springen aus jedem Winkel in jedes Gesicht, in sieben verschiedenen Größen, und das hat eine Energie im Bild, die man nicht hinkriegt, wenn man konventionell dreht. Das haben wir uns zugegebenermaßen reingepfiffen, bis wir nicht mehr konnten.
Bei den CSIs ist mir William Petersen der Nächste, also die Vegas-Variante. Gil Grissom ist die Figur, bei der sich die Autoren am meisten trauen. Der überrascht mich am meisten, der konnte ja in der letzten Staffel plötzlich die Taubstummensprache, und zwar perfekt. Die haben so viel Mut beim Erzählen, das ist so unorthodox gemacht. Von den Autoren und Figuren her finde ich diese die spannendste Variante. Und Caruso und Miami ist mir einfach zu … bunt. Also, das ist nicht mein Favorit.
Aber CSI: NY müsste Ihnen wieder gefallen.
Ja, da ich ein alter Theaterhase bin und weiß, dass Gary Sinise mit der Steppenwolf Theatre Company eine der besten Theatertruppen der USA betreibt und Herrn Sinise mehrfach auf der Bühne gesehen habe. Ich bin ein ganz großer Fan von ihm. Und ich finde die Serie auch von der Düsternis unheimlich schön gemacht. CSI: NY traut sich mal richtig dunkles Fernsehen zu machen.
Und trotzdem skurrile, kuriose Fälle zu behandeln.
Ja. Aber die amerikanische Gesellschaft hat ein anderes Verhältnis zum Verbrechen und zur Gewalt. Wenn man in Amerika eine Zeitung aufschlägt, dann haben die natürlich auch, Entschuldigung, die interessanteren Vorlagen. Dort gibt es eine Verbrechenskultur, die wir Gott sei Dank nicht haben, aber die für Filme unglaublich viel hergibt.
Was gucken Sie noch?
Dr. House, Die Sopranos, Six Feet Under, Boston Legal…
„The West Wing„?
Natürlich.
Auch Sitcoms? Was ist mit Frasier?
Frasier, herrlich! Will & Grace…
Und Will & Grace wurde Ihnen nicht nach der zweiten Staffel zu albern?
Doch, aber die ersten zwei Jahre waren großartig. Und Criminal Minds, kennen Sie das?
Ich halte das für eine der schwächeren, aber selbst das ist noch eine gut gemachte Serie.
Da habe ich gerade eine ganz tolle Folge gesehen, stilistisch unheimlich gut gemacht. Von The Unit habe ich zwei Folgen gesehen, das schreibt David Mamet, was mich sehr erstaunt hat, aber das hat mich erst mal nicht so umgehauen. Aber trotzdem: Im Großen und Ganzen ist es fantastisch, was die da drüben treiben. Und englisches Fernsehen gucke ich auch mit großer Begeisterung. Und in Deutschland möchte man immer mal so einen Wake-up-call starten.
Aber dazu gehört auch Mut von Sender- und Produzentenseite. Es ist nicht so, dass hier keine tollen Konzepte durch die Gegend fliegen. Die bekomme ich ja dauernd vor die Nase gehalten. Aber die werden dann komischerweise seltenst gemacht.
Warum nicht?
Das kann nur die Angst vor der schlechten Quote sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das hat wohl auch mit der deutschen Mentalität zu tun. Wir hatten jetzt drei oder vier Jahre lang eine Medienkrise. Die hatten die Amerikaner auch, nur ein bisschen früher. Aber in der Krise sagen die Amerikaner Okay, jetzt läuft gar nichts, experimentieren wir mal. Und dann lassen die Sachen steigen wie Six Feet Under und Sopranos und ich weiß nicht was. An dem Punkt sind die Amerikaner Unternehmer. Dann schmeißen sie auch mal zehn Piloten an die Wand, und davon bleiben zwei haften. Und die machen sie dann. Und das werden dann Welthits.
Wenn bei uns die Krise ausbricht, dann werden die Leute so panisch, dass sie überhaupt nichts mehr wagen. Sie machen nur noch das, was schon mal gemacht wurde. Wenn es irgendwie ein bisschen gelaufen ist, vielleicht können wir noch einen kleinen Hinterherkleckererfolg haben. Bei uns gibt es diese Ängstlichkeit, dass man nur noch schaut: Was macht denn der Andere, aha, damit haben die gerade fünfzehn Prozent, ah, dann machen wir das auch, nur ein bisschen halbherziger. Das hat meines Erachtens auch viel mit der deutschen Vorsicht zu tun, der deutschen Ängstlichkeit. Wir sind kein Volk von radikalen Unternehmern.
Verfolgen Sie denn auch das deutsche Fernsehen?
Oh ja. Gerade die guten Sachen schaue ich mir alle an. Aber ich schaue mir auch diese sogenannten Eventmovies an, die mich allerdings nicht vom Hocker hauen, weil es immer „Titanic“ ist vor unterschiedlichem historischem Background. Da wird eine geschätzte Kollegin zwischen zwei Herren unterschiedlicher Gesellschaftsschicht hin- und hergerissen, und das läuft dann mal vor Bombennächten in Dresden und mal vor der Sturmflut, das ist immer die gleiche Schote.
Ich schaue mir aber auch Polizeiruf 110 vornehmlich von Dominik Graf an, und es gibt tolle Bella Block-Folgen, es gibt fantastische Sachen im deutschen Fernsehen. Und ganz ehrlich: Heinrich Breloer hat für mich mal einen Meilenstein gesetzt, der hieß „Das Todesspiel“. Das war ein genialer Film. Ich möchte um Gottes Willen nicht alles niederbürsten, was hier über den Bildschirm flimmert, aber die Latte der Amerikaner liegt eben verdammt hoch.
Aber warum gelingt es bisher so selten, die Qualität, die man in vielen deutschen Fernsehfilmen vorfindet, auch auf deutsche Serien zu übertragen?
Da haben wir einfach ein Autorenproblem. Denn die guten Autoren haben keine Lust auf Serien. Wir haben bei Post Mortem wirklich alle meine Schreibidole angefragt, und die haben ohne Ausnahme abgesagt. Die haben Kinoangebote, Angebote für 90-minüter und für Mehrteiler. Die können wir für die Serie nicht gewinnen, da muss in den Schulen was passieren.
Aber mit den Büchern für Post Mortem waren Sie dann letztendlich doch zufrieden?
Weil wir an diesen Büchern immer wieder herumgefeilt haben. Da will ich niemandem einen Vorwurf machen. Es ist schwer, ein 45-Minuten-Format mit zwei Plots zu bestücken, die jeweils eigentlich ein Tatort-Plot sein könnten. Die Produktionsfirma Sony hat mir das angeboten als Autor, und ich habe es abgelehnt, weil mir das zu schwer war. Ich bräuchte für eine Folge ein halbes Jahr. Und die Zeit habe ich nicht. Ich habe jede Menge Verständnis für die Autoren, die das schreiben, aber da muss in Deutschland auch im Ausbildungsbereich was passieren, damit wir einen anderen Pool kriegen von Leuten, die dieses Format einfach beherrschen.
Aber die neun Bücher, die wir jetzt haben, kann ich wirklich vertreten. Weil auch die Kollegen, allen voran Charly Hübner, sich auf fantastische Weise eingebracht haben.
Wie reagieren die eigentlichen Autoren, wenn Sie als Schauspieler an den Dialogen herumdoktern?
Ganz kollaborativ. Unser Headwriter Lorenz Lau-Uhle ist total in Ordnung. Aber bei einer Serie ist das ein organisatorisches Problem. Der Pilot wird ein Jahr entwickelt und basiert dadurch auf einem großartigen Buch. Dann kommt der Produktionsauftrag, Der kommt aber dann, sagen wir mal, vier Monate vor Drehbeginn. Es entsteht ein Zeitdruck, bei dem die Autoren gar nicht hinterherkommen können, weil sie für die restlichen acht Folgen der ersten Staffel sechzehn Geschichten erarbeiten müssen. Das muss man erst hinkriegen. Letztendlich beginnt man dann mit den Drehabreiten, bevor die Drehbücher fertig sind. Aber wir haben es hingekriegt, das werden Sie sehen.
Da läuft wirklich ganz viel falsch in Deutschland. CSI-Produzent Jerry Bruckheimer hat dreißig Autoren zur Verfügung! Ich habe mal ein Jahr lang Highlander: The Raven gemacht, und da war direkt über dem Produktionsbüro ein Großraumbüro, da saßen zwölf Autoren und haben Highlander geschrieben. Und einmal am Tag ging der Produzent Bill Panzer durch und hat denen über die Schulter geguckt. Das läuft dort eben anders. Der Schreibbetrieb drüben ist ein Servicebetrieb. Wenn das Buch nicht funktioniert, ab in die Tonne. Wir haben aber nicht das Geld, um zu sagen, das Buch funktioniert nicht, lieber Autor X, das schmeißen wir weg, geh noch mal neu ran. Denn dann müssten wir noch mal neu bezahlen, und die Kohle wird in Deutschland nicht ausgegeben. Die Amerikaner investieren in das Buch ein x-faches von dem, was wir investieren.
Ein anderes typisch deutsches Phänomen ist, dass Schauspieler nach verhältnismäßig kurzer Zeit aus einer Serie aussteigen mit dem Argument, sich nicht auf eine Rolle festlegen zu wollen. Und gerade ein Krimi ist ja ein Format, bei dem eher die Fälle als die Charaktere im Vordergrund stehen. Ist das trotzdem ein Projekt, an das Sie sich längerfristig binden könnten?
Es ist ja meine erste deutsche Serie. Und ich habe gesagt: Ich mache das gerne, wenn ich Thomas Jauch mitbringen darf. Und diese Bedingung wurde mir von der Produktionsfirma Sony großartigerweise erfüllt. Das heißt, wenn wir eine gute Quote haben und gute Bücher bekommen, dann mache ich das weiter.
Sie könnten sich vorstellen, den Gerichtsmediziner Daniel Koch 100 Folgen zu spielen?
100 Folgen würde ich jetzt mal nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich eine weitere Staffel mache, wenn die Quote stimmt. Ich drehe als Nächstes einen NDR-Film, da spiele ich einen Konditormeister, und dann mache ich wahrscheinlich einen historischen Film fürs ZDF. Insofern langweile ich mich noch nicht als Schauspieler. Wenn ich dann zwischendurch noch mal neun Folgen Post Mortem drehe, mache ich danach wieder so radikal andere Sachen, dass ich nicht die Angst habe, mich den Rest meines Lebens in der Rechtsmedizin über Leichen zu beugen.
Michael, 14. Januar 2007, 17:26.